Verschmilzt der Planet zu einem Plastikklumpen, klammert man sich besser nicht an ein Strohhalmverbot. Ein Step-to-Step-Guide zur Selbst- und Fremdradikalisierung.
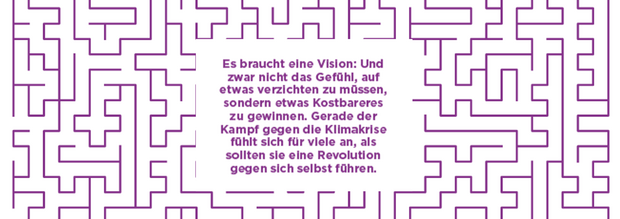
Wir, und mit wir sind tatsächlich einmal wir gemeint, also alle, die diesen Satz hier lesen, und alle, die ihn nicht lesen, wir fassen gerade in einen Fleischwolf. Was das Klima angeht, hat die Menschheit ein immer schlaueres Köpfchen und ein noch immer schlechtes Händchen: Während der Kopf genau berechnet, wie weit das Blut spritzen wird, nähert sich die Hand zielstrebig dem Einfülltrichter.
0,93 Grad noch, dann ist es zwei Grad wärmer als zu jener Zeit, als es noch keine Dampfmaschine und keine Serverfarmen gab. Was dann genau passiert, kann man im jüngsten Bericht des Weltklimarats nachlesen. In Splattermanier zusammengefasst: „This is gonna end badly.“ Flutkatastrophen hier, Monsterbrände da, Hitzewellen dazwischen. An den Fingerkuppen fängt der Fleischwolf jetzt schon mit dem Faschieren an.
1970 reichten uns die natürlichen Ressourcen eines Jahres fast bis Silvester. Heuer haben wir sie Ende Juli aufgebraucht. Seitdem blasen wir mehr Treibgase in die Luft, als Wälder und Meere aufnehmen können. Alle Bäume, die wir jetzt fällen, und alle Fische, die wir jetzt fischen, fällen und fischen wir auf Pump. Am diesjährigen Welterschöpfungstag riefen Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Klimanotfall aus: Im April schwirrte so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre wie nie. Das vergangene Jahr war das zweitheißeste jemals. Die Gletscher schmelzen um ein Drittel mehr als 2015. Wenn wir jetzt nicht schnell und grundlegend etwas ändern, stünde uns unsägliches Leid bevor.
Das ist schlimm. Noch schlimmer aber ist: Wir haben die Warnung vor zwei Jahren schon mal gelesen. Nur mit ein bisschen anderen Zahlen.
„Wir leben in einer Gesellschaft, in der Wissen gelehrt und Unwissen praktiziert wird“, schreibt der Soziologe Harald Welzer in seiner Utopie „Alles könnte anders sein“. In dieser Gesellschaft würden wir Tag für Tag lernen, wie man systematisch ignoriert, was man weiß. Tatsächlich kurbelt die linke Hand seit dem Klimanotfall Nummer eins fleißig und fossil weiter, während die rechte fast ungebremst in Richtung Messerscheibe greift.
Fast – weil wir uns an ein paar Stellen verbessert haben. Seit dem letzten Appell essen wir im Schnitt weniger Fleisch und fahren Subventionen für schmutzige Energie zurück. Wir kriegen weniger Kinder und belegen mehr Emissionen mit Klimaabgaben.
All diese Ansätze sind gut. Nur reichen, das tun sie lange nicht. Meinhard Lukas, Rektor der JKU, nennt sie „Mono-Lösungen“: Es treibt zu viel Plastik im Meer? Wir verbieten Strohhalme. Über der A12 hängt zu viel Smog? Fahren wir halt heute nur 100 km/h. Wir agieren nach dem Feuerlöschprinzip, versprühen hier und da kurzfristig lindernde Lösungen. Bis zur Ursache aber sickern sie nicht.
Kein Feuerlöscher, sondern ein Löschkommando
„Wenn es nicht möglich ist, Lösungen innerhalb des Systems zu finden, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, ob wir nicht das System ändern!“, sagte Greta Thunberg vor ein paar Jahren. Damals erntete sie viele erschrockene Blicke und wahrscheinlich ein paar Morddrohungen. Inzwischen hört und liest man die Forderung aber immer öfter, selbst in der nicht gerade linksradikalen Wochenzeitung „Die Zeit“. Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands schrieb der stellvertretende Chefredakteur Bernd Ulrich im Leitartikel, also ganz vorne: „Diese Gesellschaft redet sich gerade ein, das Klima lasse sich mit regenerativer Energie und ein paar technischen Neuerungen retten. Aber das stimmt nicht.“ Vielmehr müssten wir unser Leben ändern. Vom Weinbau über das Autofahren, von der Ernährung bis zum Häuserbau. Um den Brandherd zu löschen, braucht es nicht einen Feuerlöscher, sondern ein ganzes Löschkommando. Oder, um es so disruptiv zu sagen, wie es sich anfühlen muss: eine Revolution.
An dieser Stelle verlangen die modernen Lesegewohnheiten eine Überleitung. Doch die Krisen des Jahrhunderts sind dringlich. Deshalb nun hier, stante pede, eine Grundanleitung für einen Systemwandel.
Man stelle sich ein komplexes Problem vor. Ein tödliches Virus zum Beispiel oder ein demokratiemüdes Dorf oder eben eine langsam heiß werdende Erde. Die Lösung des Problems kann aus verschiedenen Gründen schwierig sein: Manchmal haben die am Hebel sitzenden Politiker*innen oder Vorstände keine Lust darauf – zu teuer, zu unsexy, zu großer Hustle mit der Lobby. Manchmal haben sie Lust drauf, aber die Pläne werden nicht schnell genug umgesetzt. Manchmal greifen die Pläne zu kurz. Manchmal machen nicht genug mit. Und manchmal, und der Klimawandel scheint eines dieser Probleme zu sein, da trifft alles auf einmal zu.
Das klingt überwältigend, als hätte man Gulasch vor sich und sollte daraus Salat machen. Es ist aber auch eine gute Nachricht. Glaubt man Transformationsforscher*innen, lässt sich so nämlich ein ganzer Schlag Probleme auf einmal lösen. Das Artensterben und die Klimaflucht, die Pandemie und der Halbleitermangel, die Wohnungsnot und unsere Müdigkeit und die Verschwörungstheorien und die Ausbeutung der Paketboten und die gerade am Fensterbrett der Autorin verendende Biene hängen nämlich zusammen.
Wenn alles mit allem zusammenhängt, drehen sich Diskussionen gern im Kreis. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es sich bei einer Krise um eine systemische handelt und es eine Strategie mit Weitblick braucht. Eine, die viele schlaue Leute für tauglich halten, weil in der Umsetzung realistisch und in der Auswirkung utopisch, heißt Transformative Change Making. Die Methode soll möglichst viele Menschen dazu bringen, einschneidende Reformen zu unterstützen. Eine Basic Version, die der Analyst Marc Saxer für die Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengefasst hat, geht so:
Als Erstes braucht man eine neue Art, Krisen zu analysieren. Anstatt sie als isoliertes Problem zu beurteilen („Da ist ein Virus“), für das es die eine technische Lösung gibt („Hier, ein Impfstoff“), müssen wir die Zusammenhänge sehen (Tierhaltung, Zoonose, Globalisierung et cetera). Das klingt nach einem Gemeinplatz. In einer Zeit, in der wir uns an Unis und in Unternehmen immer weiter spezialisieren, tut es aber ganz gut, sich zwischendurch daran zu erinnern, dass das nicht so sein muss – und auch nicht immer so war.
Der uomo universale der Renaissance sah die Welt noch aus einem Guss. Er bediente sich „all seines Wissens und all seiner Künste, als flössen sie aus derselben Quelle“, schreiben Meinhard Lukas und Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst, in ihrem Manifest „Innovation durch Universitas“. Den Universalmenschen hätte nur die rerum cognoscere causas interessiert, des Pudels Kern. Die Frage der Methode? War zweitrangig.
Schaut man sich die Arbeit eines solchen Universalmenschen an, die von Leonardo da Vinci zum Beispiel, aktuell ausgestellt auf der Website der Berliner Staatsbibliothek, stellt man fest: Kunst und Mathematik lassen sich ja verbinden! Physik und Literatur auch. Ab und an hat es da Vinci mit der Ambiguitätstoleranz vielleicht übertrieben. Es schadet aber nicht, weder bei der Weltrettung noch in der Liebe, die Komplexität des Lebens ein bisschen mehr zuzulassen. Wer aushält, dass die Welt mehrdeutig und widersprüchlich ist, ist bereit für Stufe zwei.
Den Status quo anders sehen und anders bewerten
„Transformation schafft immer Gewinner und Verlierer. Jene, die vom Status quo profitieren, werden versuchen, Veränderung zu bekämpfen“, warnt Marc Saxer. Viele Menschen tun lieber etwas, von dem sie zwar wissen, dass es nicht einwandfrei ist, als dass sie etwas tun, von dem sie gar nichts wissen. Status-quo-Fehler nennen Psycholog*innen diese Angst vor Veränderung.
Wie beharrlich Profiteure den Ist-Zustand verteidigen, hat Claudio Biscaro in Venedig erlebt. Zusammen mit Giuseppe Delmestri und Mia Raynard von der WU Wien dokumentierte der JKU-Professor für Leadership und Change Management 2019 den Kampf um Kreuzfahrtschiffe. Reedereien und Wirtschaftsverbände auf der einen Seite, Anwohner*innen, Politiker*innen, Kulturinstitutionen, Umweltaktivist*innen, ja quasi der Rest der Welt auf der anderen Seite. Venedig ist immerhin UNESCO-Weltkulturerbe.
„Trotzdem schafften es die Reedereien, ihre Interessen durchzusetzen“, sagt Biscaro. Mithilfe kleiner Gefälligkeiten streichelten sie die Lokalbehörden in einen Kompromiss. Die ganz großen Schiffe blieben fortan draußen und Schwefeldioxid-Emissionen wurden gedeckelt. Das meiste aber blieb beim Alten. Wirklich gut fand das nicht einmal die Tourismusbranche – Kreuzfahrtpassagiere lassen wenig Geld an Land (All-youcan- eat-Buffet) und schlafen tun sie auch an Bord.
Etwas später schärfte Italiens Regierung zwar nach: Seit 1. August fahren Kolosse, die länger als 180 Meter oder höher als 35 sind, nicht mehr unmittelbar am Markusplatz vorbei. Die Lagune aber dürfen sie weiter passieren – und damit den Meeresgrund aufwirbeln, der dann teils ins offene Meer gespült wird. Dass das problematisch ist für eine Stadt, deren Fundament auf Sediment steht, dessen ist man sich bewusst. Es wäre halt eine Lösung auf Zeit. Anstatt die Kreuzfahrt sofort ganz aus Venedig zu bannen, soll nun ein „Ideenwettbewerb“ Lösungen liefern. Lösungen – und hier liegt der Denkfehler –, die alle mitnehmen. In zwei Jahren soll das Gewinnerprojekt gekürt werden. Gekürt, nicht fertiggestellt.
Um den Status-quo-Fehler zu überwinden – Schritt drei –, müssen wir den Status quo anders bewerten. „Paradigmenwechsel sind aber keine akademische Übung“, mahnt Marc Saxer. Sie entstünden, wenn wir miteinander ringen und breite Allianzen bilden.
Weil die einen ihren Profit erhöhen wollen, die anderen keine Stimmen verlieren und wieder andere nicht ihren Job an Deck, ist das aber schwer. „Anstatt Allianzen um Interessen herum zu bilden, müssen wir sie um Erzählungen bauen“, rät Saxer. Ändern wir unser Bild von der Zukunft, ändern sich nämlich auch unsere Erwartungen. Wir berechnen Risiken neu und sehen plötzlich Verbündete, wo vorher nur Gegner*innen waren.
Verlieren wir nur unsere Finger oder gleich den ganzen Arm?
Eine gute „change narrative“ besteht aus mehreren Elementen. Zuerst braucht es ein Drohszenario, aus dem ein ethischer Imperativ wachsen kann. „Das Ferment der Revolution“, schreibt der Zeitkritiker Byung-Chul Han, sei „gemeinsam empfundener Schmerz“. Ein Weltuntergang eignet sich ganz gut.
Als Nächstes braucht es eine Vision: Nicht das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen, sondern etwas Kostbareres zu gewinnen. Gerade der Kampf gegen die Klimakrise fühlt sich für viele an, als sollten sie eine Revolution gegen sich selbst führen. Antoine de Saint-Exupéry riet einst: „Wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht Holz zu sammeln, Planken zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern mache den Menschen Lust auf das weite und endlose Meer.“
Eine Frage, die beim ersten Brainstorming hilft: Ist der Status quo wirklich so rettenswert? Oder könnte es eine Zukunft geben, die noch besser ist? Ein Venedig, das auch in hundert Jahren noch steht? Ein „buen vivir“, wie es in Boliviens und Ecuadors Verfassung steht, ein „gutes Leben für alle“?
Als Nächstes muss die Erzählung auf taugliche Werkzeuge zeigen. Das können Innovationen sein oder günstige Zeitpunkte, ein demografischer Wandel oder der sowieso bevorstehende Hafenumbau. Und schließlich, letzter Schritt, muss die Narration in Tun übersetzt werden. Hier kommen „catalytic projects“ ins Spiel.
„Einzelne kleine Projekte fühlen sich vielleicht wie ein Pflaster an, das irgendwer irgendwo draufklebt“, sagt Elisabeth Berger. „Sie schenken aber Zuversicht, dass auch große funktionieren.“ An der JKU leitet Berger das Institut für Unternehmensgründung und -entwicklung und forscht zu der Rolle von Entrepreneurship in Transformationen.
In sogenannten Urban Living Labs zum Beispiel könnten Akteur*innen sehen, wie zirkuläres Wirtschaften geht: Ein Café produziert Kaffeesatz, ein anderes Unternehmen baut darin Pilze an, die Abwärme der Plantage wiederum heizt eine Spirulina-Zucht. Das ist nicht erfunden, sondern passiert so in Rotterdam. In der „BlueCity“, einem ehemaligen Spaßbad, verweben rund 30 Jungunternehmen ihre Arbeit. „Der Konsument kann ein Pflaster auf die Klimakrise kleben, ein nachhaltiges Start-up ein anderes und eine NGO ein drittes. Das große Potenzial für schnelle Veränderung liegt aber in der Vernetzung der Akteur*innen“, sagt Berger. Eine emissionsfreie Algenzucht wird die Welt nicht rettet. Was sie aber kann: die „change narrative“ glaubhaft machen. 2050 wollen die Niederlande komplett auf eine Kreislaufwirtschaft umgestellt haben.
Dreißig Jahre noch, das haben wir ausgerechnet und in Brüssel darauf eingeschlagen, dann müssen wir die Hand zurückgezogen haben. Schaffen wir es nicht, klimaneutral zu leben, frisst der Fleischwolf nicht nur die Finger. Er zermalmt dann auch den Arm. 0,93 Grad und es folgen Ellbogen, Schulter und Rumpf, bis wir schließlich ganz verschluckt sind. 0,93 Grad und man kann zusammenstückeln, so viel man will. Fidschi ist futschi, Athen steht dann regelmäßig in Flammen und der Bach nebenan jeden Sommer im Keller. Wir sind an einem Punkt, an dem es keine Zuschauer*innen mehr gibt, sondern nur noch Beteiligte. Deshalb optimistisch zu sein, wäre schön dumm. Aber positiv, das wäre was. Das Händchen ist nämlich nicht nur imstande, abzubremsen, es könnte auch in eine ganz andere Richtung greifen.
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite








