
Wie nur wenige Orte (insbesondere in Europa) kann Linz tatsächlich von sich behaupten, vom „Digitalen Wandel“ nicht nur betroffen zu sein, sondern auch einen Beitrag dazu geliefert zu haben bzw. zu liefern und das nicht nur durch einige beachtliche Success-Stories von Start-ups oder erfolgreich international agierenden Software-Firmen, sondern, weitaus einzigartiger, auf dem Sektor der kulturellen und sozialen Bedeutung der digitalen Technologie. 1979 fand zum ersten Mal das Ars Electronica Festival statt und bereits damals wurde es explizit als Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft bezeichnet. Erdacht von einem Journalisten, einem Künstler und einem Wissenschaftler, war es bereits damals ein Prototyp für jene Interdisziplinarität, in die wir heute so große Erwartungen setzen, für die Bewältigung der großen Herausforderung, die digitale Revolution mitgestalten und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Dahinter stand die Idee, dass es möglich sein würde, durch eine vom künstlerischen Denken und Agieren inspirierte Reflexion die Transformationskräfte, die von dieser neuen Technologie auf Kultur und Gesellschaft zu erwarten waren, besser zu verstehen und ihr eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Ausrichtung zu geben. Eine Vision, die auch als Leitbild für die Transformation der Stahlstadt Linz zur modernen Technologie- und Kulturstadt große Bedeutung erlangen sollte.
Im Vorwort des ersten Festivalkatalogs schrieb man vor 41 Jahren: „Mit der Elektronik ist ein progressives Element in unsere technische Welt gekommen, dessen Einfluss sich nicht auf Industrie und Forschung beschränkt, sondern in alle Lebensbereiche eingreift. Damit ist eine Entwicklung in Gang gekommen, die erstaunliche und phantastische Aspekte eröffnet, in anderen Belangen aber auch Kritik und Skepsis hervorruft.“
Ja, eigentlich müsste man nur das Wort Elektronik durch Digitalisierung oder noch aktueller durch Künstliche Intelligenz auswechseln und schonwäre es das perfekte Statement für die Ankündigung einer neuen Universität für Digitalisierung und Digitale Transformation.
Die Notwendigkeit einer durch Kunst und die menschlichen und gesellschaftlichen Perspektiven geprägten Sichtweise auf die Potenziale der Digitalisierung ist in unseren Tagen um nichts geringer geworden – ganz im Gegenteil. Die Fähigkeit, Digitalisierung über ihre technologischen Aspekte hinaus als kulturelles Projekt zu sehen, ist auch der Schlüssel für die große Chance Europas auf eine erfolgreiche Positionierung im globalen Wettbewerb der datenbasierten digitalen Produkte und Dienstleistungen: Durch eine „Veredelung des Rohstoff s Daten“, durch die Entwicklung und Gestaltung von digitalen Anwendungen und Wertschöpfungen, die unseren ethischen und moralischen Standards standhalten können und die das Vertrauen der Nutzer*innen und Konsument*innen verdienen. Ein Vertrauen, ohne das eine digitale Gesellschaft und Wirtschaft nicht prosperieren können und das als Basis eines europäischen Wegs, eines „digitalen Humanismus“, zukunftsweisend sein kann.
Die dafür zusätzlich notwendigen Kompetenzen und Expertisen, obwohl wir sie vielfach im Detail noch gar nicht kennen, muss eine Universität des 21. Jahrhunderts abdecken können.
Von 1993 bis 2002 haben Dana Scully und Fox Mulder die Wahrheit da draußen gesucht: „The Truth is out there“, hieß es. Seit 2010 sucht Martina Seidl, Professorin für Künstliche Intelligenz an der Johannes Kepler Universität Linz, ebenfalls nach der Wahrheit. Oder vielmehr nach dem, was wahr und was falsch ist. „Meine Forschung beschäftigt sich mit der schnellen Auswertung von logischen Formeln. Mit diesen Formeln kann man Regeln ausdrücken, die eine Künstliche Intelligenz befolgen muss, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen“, erklärt Martina Seidl, womit sie sich den ganzen Tag und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit so beschäftigt. Nicht selten kommt sie sich dabei wie die beiden Akte-X-Agenten vor.
Denn das Denken um Ecken und das Lösen hochkomplexer Aufgaben sind die Herausforderungen, die sie seit Jahren begleiten. „Eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die Korrektheit von Solvern, also den Programmen, welche logische Formeln auswerten. Wenn ein Solver dazu verwendet wird, um zu verifizieren, ob ein anderes Programm korrekt ist, muss man sich darauf verlassen können, dass dieser selbst korrekt ist. Allerdings ist ein Solver meist so komplex, dass dieser selbst nicht verifiziert werden kann, und daher muss man sich andere Verfahren überlegen, um sicher zu sein, dass das gefundene Resultat stimmt. Konkret setze ich hierzu Techniken aus der Beweistheorie ein.“ Wahr, richtig, bewiesen. Es sind große Worte, die die Forschung und das Arbeiten von Martina Seidl prägen. Aber so wie der Mensch die Arbeit prägt, so prägt die Arbeit auch den Menschen. Rätsel und Herausforderungen gibt es im Leben der jungen Professorin genug. Vor allem, seit ihre neun Monate alte Tochter immer wieder die Wahrheit und die Richtigkeit der elterlichen Vorstellungen auf harte Proben stellt. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen hält sich Martina Seidl aber nicht so sehr an X-Akten, sondern lieber an einen anderen Detektiv – an jenen Mann, der in anderen Bereichen eine neue Form der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung erdacht hat. Eines der bekanntesten Zitate, das Sir Arthur Conan Doyle seiner Figur Sherlock Holmes in den Mund gelegt hat, lautet nämlich: „Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.“
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal schreibt Martina Seidl, Professorin für Künstliche Intelligenz, über das Denken um Ecken und das Lösen von komplexen Aufgaben.

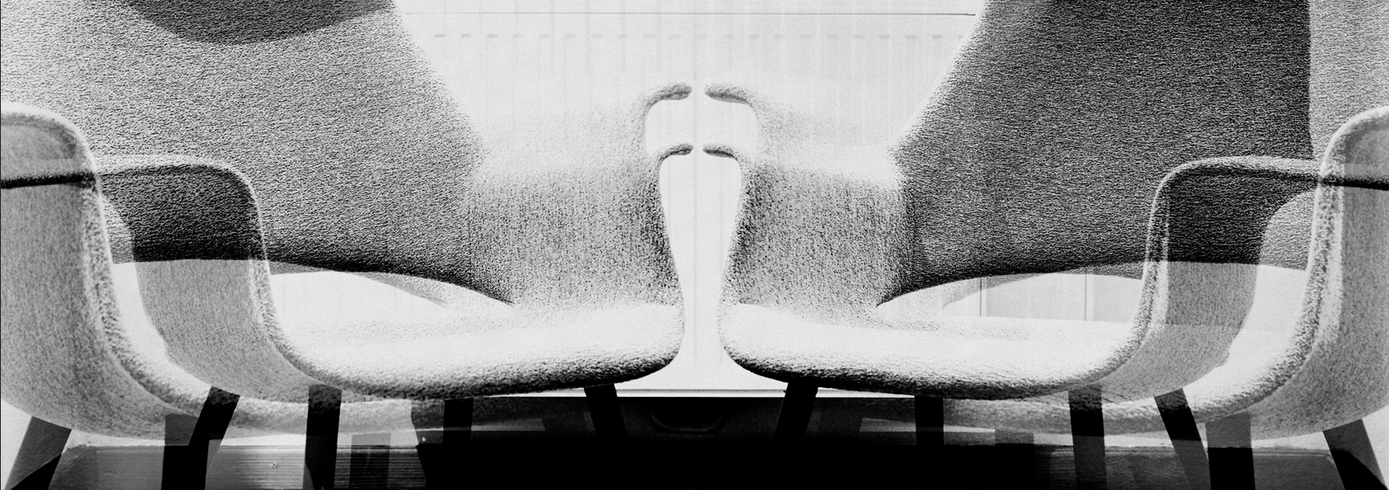
Vor einigen Jahren appellierte meine kleine Tochter an mich: „Papa, du bist ein Wahnsinn. Kannst du wieder einmal ein bisschen normal werden?“ Welche Erfahrung die Vierjährige gemacht hat, um auf einmal zu bemerken, dass ich nicht normal bin, weiß ich nicht. Ich vermeide bewusst den Konjunktiv.
Außer der Norm war ich schon als Achtjähriger, als ich Tag und Nacht die „Vierte“ von Bruckner gehört habe. Als Musikerkind greift man eben früh nach Flöte und Schallplatten – wie ein Spross eines Tischlerhaushalts vermutlich nach Hobel und Pressspanplatte. Mein Bruder ist übrigens doch Tischler geworden. Er wusste dies schon im zarten Kindergartenalter und hat nie wieder an seiner Berufswahl gerüttelt. Das Abnormale bemerken wir erst, wenn sich etwas vom Gewohnten, Üblichen zu unterscheiden beginnt. Abweichung weckt Irritation, Sehnsucht oder Neugier. In den meisten Fällen bringt sie Möglichkeiten mit sich, die mitunter gerade noch unmöglich schienen.
Unser pandemischer Ausnahmezustand zwingt uns, mit vielem anders umzugehen, als wir es gewohnt waren. Zeit, du bist ein Wahnsinn. Kannst du wieder einmal ein bisschen normal werden, zitiere ich sinngemäß meine Tochter weiter. Wobei die Frage ist, wie lange etwas dauern muss, um als Ausnahme durchzugehen, und nicht doch schon längst wieder zur Normalität geworden ist. Diese wird uns dann als neue Normalität verkauft. N. N. bedeutet normalerweise Nomen nescio, Nullum nomen, Nomen nominandum bzw. Numerius negidius, was in etwa meint, dass ein Name bekannter- oder unbekannterweise nicht oder noch nicht genannt wird oder werden kann. Danken Sie dieses Wissen nicht mir oder meiner verehrten Latein-Professorin, sondern Wikipedia. Es lebe das im Netz verifizierte Halbwissen.
Wir brauchen die Norm als Geländer, um uns orientieren zu können. Sie wird damit zu einer stillen Vereinbarung, deren Zustimmung gar nicht erst eingeholt werden muss. Insofern könnte man das Normale als kulturelle Übereinkunft betrachten. Ausgerechnet auf einem Geländer, das vor der profanierten Linzer Kapuzinerkirche die Fußgehenden vor dem Autoverkehr schützt, habe ich den Satz entdeckt: „Du bist der Stau.“ Während ich auf das Einfädeln in die Hopfengasse warten musste, nahm ich diese Ansage im Auto sitzend wahr. Alle heimischen Autofahrerinnen und -fahrer kennen diesen neuralgischen Punkt im Linzer Verkehrsgeschehen. Wenn man endlich drankommt, ist es immer wieder ein kleiner Kick, ob man es im kleinen Zeitfenster schafft, sich Richtung Römerbergtunnel einzugliedern. Unbeschwertes Vorankommen passiert woanders, wobei die Chancen auf Verkehrsbehinderungen in Linz generell nicht so schlecht stehen. Aber dies will hier nicht weiter Thema werden. Du bist der Stau, wird einem hier auf den Kopf zugesagt. Noch dazu ist der Blickwinkel so gewählt, dass dies nur aus dem stehenden Auto zu lesen ist.
Als Lehrer, der ich drei Jahrzehnte sein durfte, war ich immer auf der Lauer, solche Situationen herbeizuführen. Man legt einen zufälligen Stolperstein, bastelt eine Engstelle, an der die Schülerin, der Schüler vorbeimuss, und dadurch etwas erfährt, was obendrein und nebenbei noch unverständlich benannt wird. Wie wir alle wissen, lernen wir am besten durch Erfahrung. – Oder auch nicht, wenn die oberste Prämisse ist, an der – weiß ich wie alten – Normalität festzuhalten.
Wenn die Erfahrung dann gleich noch in einem klaren theoretischen Überbau – wie einem einfachen Satz – bewusst vertieft wird, könnte man dies als Beispiel formvollendeter Pädagogik anführen und zeigen, wie sehr sich Theorie und Praxis bedingen. Pädagogik ist die Kunst des gut argumentierten Fallenstellens. Mitten im Stau wird mir bewusst, dass ich es bin und nicht die Anderen. Würde ich aufs Auto verzichten, stünde ich nicht nur mittendrin, sondern würde einen Beitrag zur Entspannung des Verkehrs an dieser Stelle leisten. Die Würde gehört dem Indikativ, nicht dem Konjunktiv und Eigenverantwortung ist nicht das Gegenteil von Verantwortung. Sobald wir in die eigene Verantwortung gehen, nach eigenen Antworten suchen, finden wir sie auch für unsere Mitmenschen. Wobei am gleichen Strang zu ziehen noch gar nichts heißt, wie der große Helmut Qualtinger schon wusste: „Auch Henker und Gehenkter tun das.“
Ein Stau kann viele Gründe haben und entsteht nie aus dem Nichts. Meist sind die Verursachenden gar nicht ins Staugeschehen verwickelt, sie lösen nur aus, was zu einer Kettenreaktion führt. Damit fehlt oft der Lerneffekt für die Aus- und Leidtragenden, die sich einem unüberlegten und teilweise gefährlichen Fahrverhalten anpassen müssen, um selbst sicher weiterfahren zu können. Menschen machen einfach zu viele Fehler. Sie fahren zu dicht auf, sind einen Moment lang unaufmerksam und müssen dann scharf bremsen, was ein Stauauslöser sein kann. Aufmerksamkeit ist ein großes Thema. Sind Sie schon einmal in Rom Auto gefahren? Würde man ins römische Verkehrsgeschehen nur Autofahrende österreichischer Art und Gewohnheit verpflanzen, würde es permanent krachen. Wir sind viel zu lahm in unserer Reaktionszeit. Nebenbei bemerkt, geht dort nicht gleich die Welt unter, wenn es doch einmal zu einem Kratzer durch Kontaktnahme kommt. Der Stoßstange werden nicht nur ästhetische Qualitäten, sondern auch eine abfedernde Funktion zugemutet.
Ganz anders geht es im Tierreich zu, für Ameisen ist zum Beispiel das sichere und stetige Vorankommen aller Verkehrsteilnehmenden das Ziel. In der Forschung beobachtet man Tierschwärme, um herauszufinden, wie der Verkehr effektiver gestaltet werden kann. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass Ameisen selbstlos sind. Sie orientieren sich an den Langsamen, wer stehen bleiben muss, tritt zur Seite. Ist Selbstlosigkeit gar ein guter Ansatz hin zur Eigenverantwortung? An der Wortoberfläche würde man dies auf den ersten Blick gar nicht vermuten. Speed kills Eigenverantwortung.
Wir erleben eine sehr fragile Zeit und müssen als Gesellschaft aufpassen, dass die Risse, Gräben und Unterschiede nicht immer noch größer werden. Unsicherheit ist aber immer die große Zeit der Möglichkeiten, auch jener, uns wieder als Gestaltungsbefähigte mit Verantwortlichkeitsveranlagung – man könnte auch Empathie sagen – zu begreifen. Jede, jeder hat Einfluss und es ist höchste Zeit, diesen in Anspruch zu nehmen. Wer es nicht tut, stimmt dem Lautesten zu. Wir können bis zum Sankt Nimmerleinstag diskutieren, ob diese oder jene Maßnahme hilft, oder jene nicht. Nur um nicht missverstanden zu werden, ich finde einen fundierten Diskurs unentbehrlich. Dieser sollte auf wissenschaftlicher Basis, mit Vernunft und Mitgefühl passieren. Was ich vermisse, ist, dass wir vieles nicht mehr bereit sind zu tun, wenn es nicht unser ureigenes, unmittelbares Hoheitsgebiet betrifft. In allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen höre ich seit Jahrzehnten, da könne man nichts tun, dahinter stecken Weltkonzerne, der Chef, die falsche Partei, das rechte Netzwerk, der linke Nachbar oder das schlechte Wetter. Stimmt, gegen das Wetter sind wir machtlos, können aber zu Hause bleiben, wenn es zu stark regnet. Es ist doch gut, wenn man ein Dach über dem Kopf haben darf. Was für viele Menschen gar nicht selbstverständlich ist.
Wir können immer etwas ändern, und wenn es nur für uns ist. Gibt es eigentlich eine radikalere Veränderung als eine selbstverursachte, die einen selbst betrifft? „Wenn ich auch nur im Geringsten dafür verantwortlich bin, dass Menschen in ihrem Inneren mehr Persönlichkeiten entdecken, als sie ursprünglich vermuteten, dann bin ich zufrieden“, sagte David Bowie im Gespräch mit Alan Yentob im Dokumentarfilm „Cracked Actor“ (1975). Ich bin der Stau, ich bin die zweite Welle, ich bin das Klima, ich bin Gesellschaft, ich bin Welt. Die Inanspruchnahme von Verantwortung erfordert nicht immer sofort Heldenmut. Ich bewundere Menschen, die ihr Leben für eine kollektive Sache einsetzen. Dafür bin ich viel zu feig. Es gibt so viele Möglichkeiten, bevor man sein Leben aufs Spiel setzt. Sitzen bleiben ist keine und manchmal doch eine. Das ist Freiheit.
An einem Tag, an dem sehr viel konzentriert zu schreiben ist, fahre ich handlungsbereit ins Büro. Als ich die Garage öffne, fallen mein Blick und das Tageslicht auf eine dieser solarbetriebenen Winkekatzen, die dienstfertig ihren Daseinszweck erfüllt. Meine Schwester, mit der ich das Haus wechselweise bewohne wie Sonne und Mond den Himmel, möchte die seltsame Apparatur auf der Hutablage befestigen, damit sie Geld und Glück hereinwinke, aber vor lauter Arbeit kommt sie nicht dazu.
Ich versuche, ohne Ablenkung in mein Bürobaumhaus zu steigen, um diesen Text hier zu schreiben. In den vergangenen zwölf Jahren meines Home-Office habe ich das Konzept von Scheuklappen zu verstehen gelernt. Denn der Haushalt hascht mit minder wichtigen Aufgaben nach meiner Aufmerksamkeit. Noch schaffe ich es über den Rasen, der schon aussieht wie unsere Frisuren kurz nach dem Lockdown, und ich schaffe es die Leiter hinauf – aber drinnen liegen sieben Staubflankerl, sodass ich gleich einem Putzanfall erliege, nachdem ich dann auch Hunger bekommen und gekocht habe, ist es auch schon wurscht, und ich mähe den Rasen. Gibt es so etwas wie Alters-ADHS?!
Zu meinem Erbe gehört nicht nur ein alterndes Haus, sondern ein Mühlviertler Arbeitsethos, das in den Früchten sitzender Denkarbeit keine ordentliche Ernte sieht. Um diesen skurrilen Selbstboykott zu überwinden, bräuchte ich eine zweite Meindl, der ich zufrieden dabei zusehen könnte, wie sie mir die Frackhemden bügelt und den Giersch aus dem Garten rupft. Und ich selbst, das Original, könnte endlich schreiben! Oder nur ganz schnell auf Facebook nachschauen, ob das Posting mit dem Hunderl … und auf Instagram … Als Kompromiss öffne ich meine drei Mail-Accounts und mache mich an die Administration meines Erwerbslebens, also höflich Honorare einfordern, Kollegen Links für die diversen Härtefallfonds googeln, Sitzungsprotokolle korrigieren, der Kulturdirektion Anregungen für ein Kulturkonjunkturpaket aufdrängen. Fürs konzentrierte Schreiben ist es schon lange zu spät, morgen geht’s bestimmt locker, da ist ja dann auch der Rasen gemäht! In der Garage winkt die Katze weiter mit sinnloser Tüchtigkeit. Kann dieser alte Fleiß – so etwas wie das Korsett im Leben meiner Vorfahren – nicht langsam weg wie die hölzernen Rechen, Sensen und Dreschflegel in der Gartenhütte? Wenn sie ihm lustig sei, dann sei es keine Arbeit mehr: ein Zitat meines Großvaters. Fleiß ist kein Wert an sich. Bei der Fahrt in die Kletterhalle überfällt mich schlechtes Gewissen. Wieder nichts fürs OEuvre weitergebracht! So ein leistungsarmes Leben kann sich nur leisten, wer geerbt hat! Im Ernst, was ist los mit mir? Wenn das so weitergeht, bin ich ersatzlos durch einen Schreib-Bot zu ersetzen. Weil ich gestern Zeitung gelesen habe, statt zu schreiben, weiß ich heute leider, dass laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Maschinen und Algorithmen bald jeden vierten Job übernehmen könnten. Wir Autorinnen sollten uns nicht sicher fühlen, es ist ziemlich unheimlich, wie gut digitale Schreibprogramme mittlerweile unsere poetische Arbeit imitieren. Versuchen Sie es selbst einmal mit dem „artikelschreiber.com“. Das kann man amüsant finden – oder beängstigend. Vom Zeitfaktor sollte ich gar nicht reden. Zwischen dem Auftrag für diesen Text und seiner Endfassung liegen sechs Wochen, dabei hätte ich mich in dieser Zeit nur ein einziges Mal für ein paar Stunden hinsetzen müssen. Chat-Programmen hingegen baut man eine kleine Verzögerung bei ihren automatischen Antworten ein, damit der fragende Mensch nicht durch übermenschliche Schnelligkeit erschrickt. Möglich, dass „Roboterliteratur“ bald die Science-Fiction verlässt und die Belletristik erobert. Gut, dann könnte ich den ganzen Tag im Garten kramen wie ein hyperaktives Eichkätzchen, aber ohne bedingungsloses Grundeinkommen käme ich nicht einmal durch den ersten Winter. Und es wäre auch eine moralisch sinnlose Existenz.
Während des Trainings wäge ich ab, ob es nicht klüger wäre, mich durch eine intelligente und vor allem tüchtige Androidin meiner selbst zu ersetzen, dann könnte ich seelisch ungestört bouldern, während sie meinen Roman über die chinesische Kopie von Hallstatt fertig schreibt, natürlich anhand von Big-Data-Algorithmen, nach denen ein garantierter Bestseller funktioniert.
Später, auf der Couch des Mannes, den ich von allen am liebsten besuche, denke ich – verursacht durch ein Glas Rotwein – emsig nach. Muße muss man sich leisten können. Disziplinlosigkeit ist ein Privileg. Während ich launige Facebook-Postings über Prokrastination im Home-Office schreibe, brennt sieben Häuser weiter eine rumänische Pflegerin aus, weil sie sich um eine verängstigte demente Frau kümmert, die ihr keine ruhige Minute lässt. Schön, wenn die Digitalisierung eintönige und anstrengende Arbeiten übernimmt, aber was machen die Leute, die bislang damit ihr Existenzminimum verdient haben? Wer Automaten und Algorithmen nicht für die Befreiung der Menschen hackeln lässt, soll sich in einer ruhigen Minute fragen, ob er ein profitgieriges Miststück ist. Pardon, das war zu grob, zu plakativ! Es liegt am zweiten Glas Rotwein, da geht’s mit mir durch. Ich komme sehr gut damit klar, dass mit meiner Berufswahl ein bohèmehaftes Leben einhergeht, Klagen über Honorare gehören im Literaturbetrieb zum guten Ton. Aber mich ärgert, dass wir in einem stinkreichen Land fast 300.000 „working poor“ haben, und die Pandemie wird diese Zahl bestimmt nicht senken. Es zipft mich enorm an, dass Frauen, die ihr Leben lang die eigenen Bedürfnisse hinter die der Familie gestellt haben, sich mit einer lachhaften Pension durchfretten müssen. Es nervt exorbitant, dass Schulpsychologinnen und Sozialarbeiter eingespart werden. Und gibt es einen vernünftigen Grund, warum Kindergartenpädagoginnen so mies bezahlt werden? Konzernführer und Wirtschaftsminister und Industriellenvereinigungspräsidenten (ich gendere hier nicht) lassen sich offensichtlich vom Wachstum der Wirtschaft so ablenken wie ich mich von jenem meines Rasens. Die Frage, was wir mit der frei werdenden menschlichen Arbeitskraft anstellen, ist wohl auf morgen verschoben. Offensichtlich ist es wichtiger, dass nur bloß niemand in der sozialen Hängematte lungert. Leistung muss sich lohnen! Da fällt mir wieder der dumme Fleiß der Winkekatze ein. Faulheit kann man den Maschinen nun wirklich nicht vorwerfen.
Hier mein Vorschlag zur Güte, ganz ohne Big-Data-Analyse über gelingendes Menschsein: Alle, die noch physisch arbeiten müssen, sollen flugs wohlhabend und hoch angesehen werden. Alle, deren Arbeit wegfällt, sollen sich flugs und bestbezahlt um andere Menschen kümmern. Wenn die Automatisierung nicht dazu dient, dass ALLE an den Segnungen der Arbeitserleichterung teilhaben, ist das nicht meine digitale Revolution. Den Entscheidungsträger, der mir widerspricht und panisch „Diktatur! Maschinensteuer!“ greint, lade ich zu einem Besuch in eine städtische NMS oder in ein Bezirksaltenheim oder auf ein Spargelfeld ein. Und wenn er dann noch glaubt, dass die Wirtschaft die Arbeitsplätze schafft und nicht die Menschen selbst, dann haue ich mit kletterhallenstarker Faust auf den Tisch.
Auch am nächsten Arbeitstag, am Tag der Deadline für diesen Text, winkt mir die Katze zu, als ich voller Tatendrang ankomme, und sie winkt mir zu, als ich am Abend Richtung Kletterhalle wegfahre, nachdem ich schon wieder nicht mehr als ein paar Notizen hingekriegt habe, weil sich überraschend Besuch eingestellt hat. Aber einen Tag so zu vertändeln – das soll mir ein Roboter einmal nachmachen!


Es begann mit dem Schutz von Fischen an der Großen Rodl – und am Ende stand ein an der JKU entwickelter Prototyp einer
Maschine, die die Metastasierung von Krebs im menschlichen Körper eindämmen könnte. Wie das eine zum anderen kam? Eine Chronologie.
Nichts geschieht durch Zufall. Nichts ist, wie es scheint. Und: Alles ist miteinander verbunden. Das sind die wichtigsten Ingredienzien für eine Verschwörungstheorie. In Zeiten von Corona funktionieren sie besonders gut. Auch wenn sie noch so falsch sind. Warum ist das so?


Das vergangene Schuljahr endete mit kollektiver Überforderung. Wie stehen die Chancen, dass es besser wird? Karin Leitner über bildungspolitischen Katastrophenschutz.
Die Prognosen von der schönen, neuen Post-Corona-Welt erwiesen sich als heillos übertrieben. Oder zumindest als verfrüht. Ein Systemwandel ist nicht in Sicht.

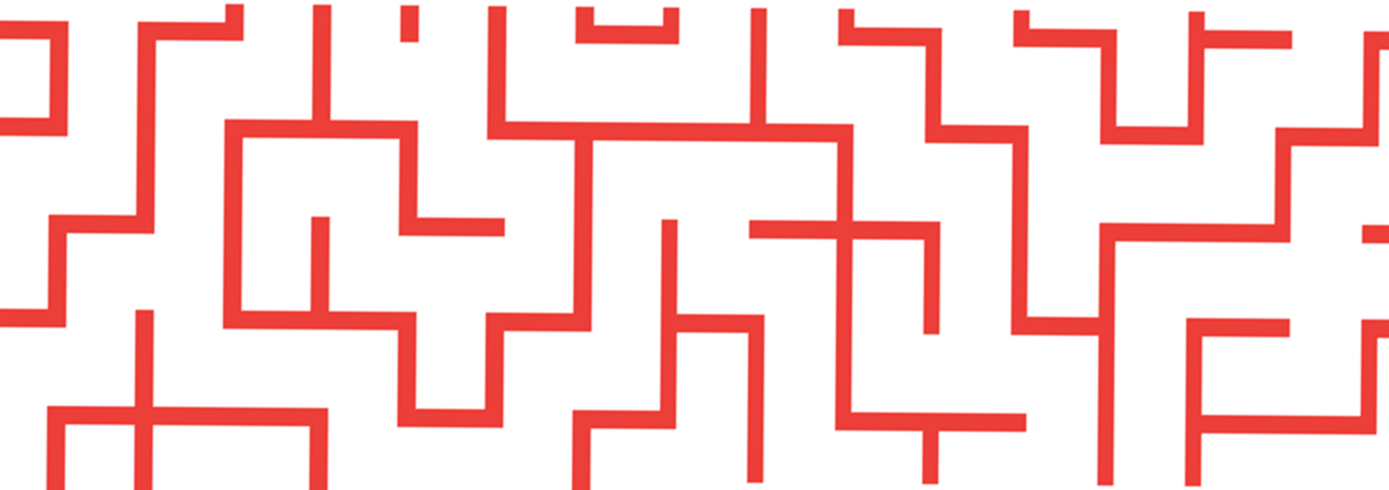
... zahle es, wer mag. Politische Entscheidungen in Zeiten der Corona-Krise. In der Auseinandersetzung mit den Folgen werden uns Masken nur bedingt helfen.
In die Zukunft denken, Innovation erkunden und zugleich mit Formen des Diskurses experimentieren: All das hat mit der DNA des Ars Electronica Festivals zu tun. In der Corona-Krise mutiert das Linzer Medienkunstfestival nun selbst zu einem Prototyp.
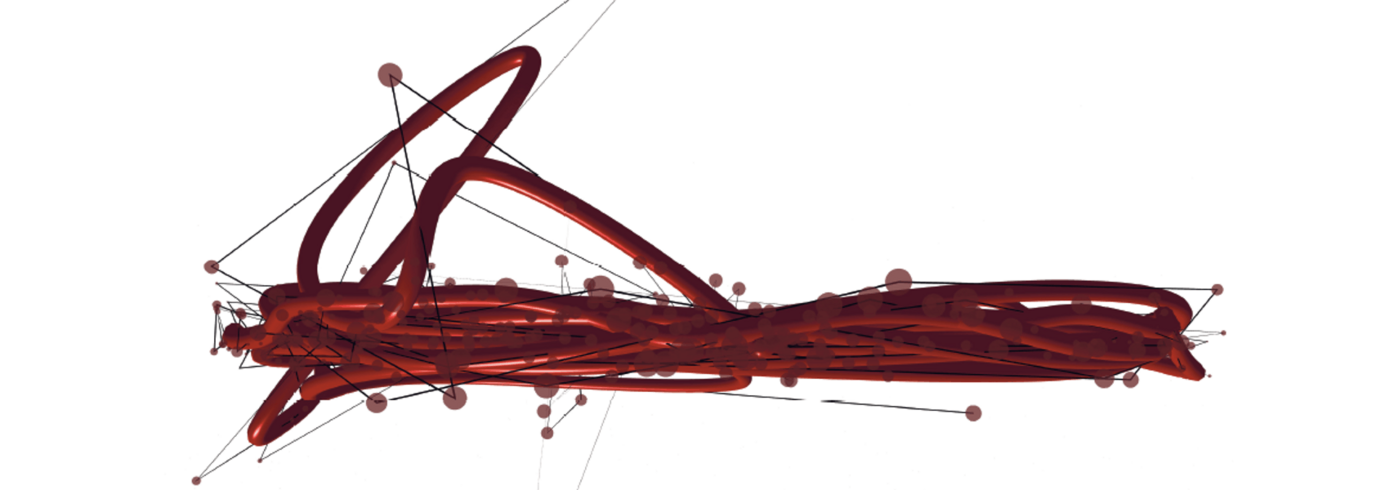

COVID-19 hat gezeigt, wie unerwartet schnell die gesellschaftliche Normalität dystopische Züge annehmen kann, sei es die Staatskontrolle in China, sei es die zur Schau gestellte Verantwortungslosigkeit eines Trump oder Bolsonaro, aber auch in Europa. Mehr als zehn Jahre Austerität nach der Finanzkrise haben den Gesundheitssektor an Grenzen gebracht, an denen die Triage über selektives Überleben entscheiden sollte. Der wirtschaftliche Shutdown hat nicht nur Dividenden, sondern Existenzen einbrechen lassen. Der soziale Shutdown hat gezeigt, dass dem Beziehungswesen Mensch die digitale Welt allein nicht genügt und wie schnell demokratische Formen politischer Willensbildung gefährdet sind, wenn Machthaber* innen die Ungunst der Stunde zu weiterer Selbstermächtigung nutzen. Der kulturelle Shutdown hat nonkonformistische Künstler*innen, die nicht von der „Kulturindustrie“ (Adorno/ Horkheimer) leben, besonders getroffen. COVID-19 hat eine Idee davon vermittelt, auf welche Zivilisationskrisen sich die Gesellschaft zu bewegt, wie sozial, politisch, kulturell arm sie sein wird, wenn sie nicht umdenkt. Ein im Wortsinn radikales, an die Wurzeln des Übels heranreichendes Umdenken ist erforderlich.
Die Pandemie und weitere sozial-ökologische Gefährdungen wie der Klimawandel hängen engstens mit dem wirtschaftlichen Raubbau an den Lebensgrundlagen der Menschheit zusammen. Dieser Raubbau hat mit dem Industriekapitalismus begonnen und gefährdet im Finanzmarktkapitalismus das Überleben. Weder lassen sich Katastrophen wissenschaftlich-technologisch beherrschen, wie das moderne Fortschrittsdenken immer wieder glauben machen will, noch sind die finanzmarktkapitalistischen Wachstumsimperative mit einer nachhaltigen Lebensweise vereinbar.
Zeiten großer Wirtschaftskrisen – und nicht nur die Länder Europas sind bereits mittendrin – waren immer auch Zeiten verschärfter sozialer Ungleichheiten und tiefgehender gesellschaftlicher Spaltungen, die der Demokratie an die Substanz gegangen sind. Sie fordern zur Auseinandersetzung heraus, wie gewirtschaftet und gelebt werden kann und soll. In der Gegenwartsgesellschaft gibt es zahlreiche „reale Utopien“ (Wright) solidarischen Zusammenlebens, sozial- ökologisch nachhaltigen Wirtschaftens und deliberativer politischer Willensbildung. Sie tangieren die „kleinen Fragen“ des Alltags – vom öffentlichen Nahverkehr bis zum Mehrgenerationenhaus – ebenso wie die „großen Fragen“ von industriellem Umbau, Wirtschaftsdemokratie und Sozialstaatsentwicklung. Es geht mir nicht darum, welche Wege hier beschritten werden können und sollen, aber die Gesellschaft ist gefordert, sich damit zu befassen, bevor die Dystopie mehr und mehr zur Realität wird. Margaret Thatchers berühmter Satz in Sachen Wirtschaftsliberalismus passt, wenn die Menschheit überleben will, besser für sein Gegenteil, die Utopie einer solidarischen Gesellschaft: There is no alternative.
„Denken heißt überschreiten!“, schreibt der Philosoph Ernst Bloch in seinem Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“. Er meinte damit nicht nur das Überschreiten der von anderen gesetzten Grenzen, sondern auch das Überschreiten von selbst gesetzten Grenzen, die uns daran hindern, Möglichkeiten als realisierbare Ideen zu sehen, als Utopien, und nicht als unerreichbare Traumbilder. Bloch stellte den Begriff der Utopie in einen Zusammenhang mit dem Begriff der Hoffnung, den er als Bereitschaft zur Eroberung des Neuen sah. „Es kommt darauf an, das Hoff en zu lernen“, ermuntert uns Bloch. Hoffen kann man nur über das Bestehende hinaus; den Status quo braucht man nicht zu erhoffen.
Eine Gesellschaft, die nicht in Nostalgie ertrinken oder im Pragmatismus ersticken will, braucht die Kraft von Utopien. Kraft erlangen Utopien allerdings nur, wenn man ihnen den defätistischen Makel nimmt, das unrealisierbare Produkt weltabgewandter Traumtänzerei zu sein.
Die Abschaffung von Sklaverei und Leibeigenschaft, gleiche Rechte für Frauen und Männer, der demokratische Rechtsstaat, die Geltung der Menschenrechte, die Reise zum Mond, die Gründung der UNO und der EU ... all diese Ideen waren zu bestimmten Zeitpunkten Utopien – konkrete Utopien, weil Menschen an ihre Realisierbarkeit glaubten und dafür gekämpft haben, dass diese Utopien gesellschaftliche und politische Anerkennung erhalten und als ebenso realisierungswürdig wie realisierungsfähig angesehen werden.
Eine utopische Antwort auf die noch kaum erkennbaren Herausforderungen der beginnenden ersten industriellen Revolution war die Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Der Unterricht an den Schulen des Dampfmaschinenzeitalters konzentrierte sich übrigens nicht auf das Verständnis und die Bedienung von Dampfmaschinen.
Heute verändern die Klimakrise und eine naturwissenschaftliche/ technische Revolution wieder einmal das Leben der Menschheit. Nur viel schneller und tiefgreifender als je zuvor.
Wie können wir Arbeit, Bildung, Wirtschaft, Politik und die Rolle des Menschen im Zeitalter von Digitalisierung, Gentechnik und Quantentechnologie neu definieren, bevor sich das Zeitfenster für sozial verträgliche Gestaltungsmöglichkeiten schließt?
Der Radikalität unserer Zeit kann man nur mit der Radikalität von Utopien gerecht werden. Die Kunst kann das. Und die Wissenschaft kann das. Gemeinsam könnten sie im Bloch’schen Sinne zu Hoffnungsträgern für die Eroberung des Neuen werden. Denn die zielgerichtete Verbindung von wissenschaftlichem, technologischem und künstlerischem Denken ist ein wichtiger Ansatz, wenn nicht eine Voraussetzung, um konkret-utopische Strategien für die komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.


Jetzt ist schon wieder was passiert. Das hat er sich oft gedacht, der Breneis Simon. Also eigentlich hat er sich das fast immer gedacht. Zumindest immer dann, wenn es eine Mathematik-Prüfung gab. Das kann er nämlich. Das mit den Zahlen und dem Denken. „Wenn was mathematisch bewiesen wurde, dann hat man die absolute Sicherheit, dass es auch wahr ist.“ Das hat er einmal gesagt, der Breneis. Da hat man schon gewusst: Wenn einer so was sagt, dann wird das was werden mit der Mathematik. Und dann ist es halt auch was geworden mit der Mathematik. Weil bei jeder Prüfung was passiert ist. Was Gutes. Ganz oft. Deshalb ist der Breneis einer der jüngsten Mathematik-Master aller Zeiten an der JKU geworden. Mit gerade einmal 20 Jahren.
„Mathematik kann unheimliche Freude bringen, wenn man sie versteht, und gleichzeitig tief verzweifeln lassen, wenn man nicht mitkommt.“ Auch so was sagt der Breneis. Da spürt man dann ein bisschen, dass er verliebt ist. In das, was er tut. Und so, wie man bei der Liebe ja auch nicht weiß, warum sie einen erwischt, weiß der Breneis Simon auch nicht so genau, warum das mit der Mathematik und ihm halt so ist, wie es ist. Da kann man sich nicht wehren, sagen die Leute. Also gegen die Liebe, die fällt halt hin, wo sie hinfällt. Beim Breneis zur Mathematik. Oder bei der Mathematik zum Breneis. Das kann man sehen, wie man mag. Und wahrscheinlich ist beides richtig. Aber die Geschichte vom Simon und der Mathematik sagt auch was vom Träumen. Weil es ist ja schön, wenn man so träumt. Nur, wenn dann nix davon überbleibt, wenn man nicht mehr schläft, was ist dann so ein Traum eigentlich noch?
Gut, dass der Breneis das nicht kennen muss. Weil der lebt seinen Traum. Aber wenn man ihn so reden hört von Gleichungen, Vermutungen und Funktionen, dann spürt man, dass der Breneis noch Pläne hat. Und Träume. Vom Denken, vom Rechnen und vom Lösen großer Rätsel. Und dann hat man von einem 20-jährigen Mathematiker ganz viel gelernt. Von der Liebe, vom Glück und vom Glücklichsein. Und deshalb ist der Breneis nicht nur gescheit, sondern wirklich weise.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal schreibt Simon Breneis, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Institut für Analysis, über die Faszination Mathematik.


Ein Spätsommerabend, die Donau strömt wie flüssiges Silber, der Kellnerandroid stellt mit zurückhaltender Verbeugung zwei goldschimmernde Gläser Schlägl Kristall vor uns hin, denn ich bin eine liberale Autokratin, die viel Verständnis für die Bedürfnisse von Männern hat. Und trotzdem haben die Augen meines Neffen ihren Glanz verloren. War ich zu harsch mit ihm? Bestimmt. Man redet der Jugend nicht ihre Zukunftsvisionen schlecht. Ich lege meine Hand auf seine Schulter. „Wenn du es wirklich willst, kannst du natürlich BWL studieren!“ Sein Kinn zittert. „Es ist mir egal, ob das eine brotlose Kunst ist, ich will Unternehmensberater werden!“, sagt er, und es klingt nicht so trotzig, wie er denkt.
Er hat es nicht leicht als Patenkind einer Despotin. Noch dazu einer, die es gegen die Wirtschaftselite durchgesetzt hat, dass Menschen radikal nach dem gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit und ihren Möglichkeiten bezahlt werden. Da macht man sich ein Geschwader an Feinden, und Sippenhaft ist für Marvin kein Fremdwort. Aber anders hätte das Matriarchat keine Mehrheit gefunden. Bizarr eigentlich, dass wir Frauen uns Jahrtausende lang dermaßen sekkieren lassen haben! Und dass es dieser Seuche bedurfte, um die Revolution auszulösen! Was die Jungen heutzutage gern vergessen, weil es ihnen schon zu gut geht unter meiner Obhut: 85 Prozent der verlorenen Arbeitsplätze waren jene von uns Frauen! Gleichzeitig haben sich die Herren vorgestellt, dass wir zu Hause unbezahlt putzen, pflegen, kochen, unterrichten – und dann auch noch Diät halten, damit wir während des Lockdowns nicht blad werden. Darum ist es mir ungemein wichtig, dass „Frauenkolonialismus“ heute, zwanzig Jahre später, im Lehrplan aller Schulen steht. Jetzt lernt jedes Kind Gerechtigkeitsgeschichte – wenn sie hören, dass Frauen noch im 20er-Jahr 41 Prozent weniger Pension bekommen haben, reißen die Kleinen die Augen auf.
„Muss es denn unbedingt BWL sein?“, frage ich den einzigen Sohn meines Bruders, „wie so ein Betrieb geht, ist doch keine Wissenschaft.“ „Aber der Staat ist ein schlechter Wirtschafter …“, will er sagen, doch ich haue so fest auf den Tisch, dass die anderen Gästinnen sich zu uns umdrehen. „Ich bin der Staat!“ Gut, ein Totschlagargument. „Und wir sind ein stinkreiches Land!“ Marvin gibt noch nicht auf: „Es gibt so viel Sparpotenzial! Ohne Wettbewerb fehlen uns die Innovationen!“ Jetzt werde ich böse. „Schatzi, du willst mich provozieren, das ist dein gutes Recht. Aber es steht nicht ohne Grund in der österreichischen Verfassung, dass Kooperation Mittel unseres Wirtschaftens ist, WEIL ES OBJEKTIV STIMMT!“ Der ganze Gastgarten brummt zustimmend wie ein Hummelschwarm. Ich senke meine Stimme. „Wozu haben wir alles digitalisiert, wenn wir uns nicht das Leben schön machen? Lass’ die Menschen doch so arbeiten, wie es ihnen lustig ist, das geht sich alles aus!“ Er murmelt etwas von „da ginge mehr fürs BNP“, ich knurre. „Marvin, willst du an den Stammtischen der Patriarchen enden, die in ihre Biere weinen? Die greinen, dass der Markt alles regeln soll?“ Er schüttelt den Kopf, nein, zu diesen Außenseitern will er nicht gehören. Dann lächelt er endlich. „Tante Dominika, ich hab’s! Die sitzen im Abseits, weil der Markt wirklich alles regelt, drum haben sie nix mehr zu melden!“ Wir lachen beide herzlich, er ist halt doch mein schlauer Lieblingsneffe, und nein, ich bin nicht traurig, dass es in meiner Familie keine Stammhalterin gibt. Was wäre denn das für ein modriges Denken?
Oft fragen mich ausländische Journalistinnen, warum ich kapitalistische Thinktanks als Subkultur nicht nur zulasse, sondern sogar fördere. „Schauen Sie“, sage ich, „die Mittel stellt meine Männerministerin zur Verfügung, um den sozialen Frieden zu gewährleisten.“ Damit dürfen die Leistungsfetischisten ihre schlecht besuchten Hayek-Leseabende veranstalten, Lyrik über ihre Sehnsucht nach dem Neoliberalismus schreiben oder Ironman-Triathlons organisieren. Es ist wie mit Fuhrknechten oder Bergarbeitern! Wir müssen auf die Menschen schauen, besonders wenn ihre Branchen obsolet werden! Meine Position ist so gefestigt, dass sie es leicht aushält, wenn sich Marktromantiker und Kooperationsleugner daran reiben. Die Gerechtigkeitskritiker dürfen behaupten, was sie wollen, zum Beispiel den ganzen Tag, dass man wegen der politischen Korrektheit gar nichts mehr sagen darf. Sie müssen dafür nur eine Freikirche gründen, denn da geht es um persönliche Glaubensgrundsätze. Die Katholiken glauben ja auch an eine jungfräuliche Geburt, also wo fange ich bei den Privatisierungs- Esoterikern an, wenn ich das rational angehe? Und warum auch? Ich will, dass die Menschen glücklich sind. Eine Diktatorin hat Besseres zu tun, als sich in das Privatleben ihres Volkes einzumischen. Aktuell denke ich etwa an einen Matriarchats-Export in andere Länder, aber nicht militärisch, sondern durch Soft Power. Wie ich damals dem Trump den Krieg erklärt habe, persönlich natürlich, nur Schwächlinge brauchen Waffen, und ihn mit dem ersten Schwinger an sein breiiges Kinn von den X-Beinen geholt habe, das hat schon weltweit Eindruck gemacht.
So, jetzt wird es zu albern. Schluss mit diesem demokratisch fragwürdigen Tagtraum! Lassen Sie mich den verbleibenden Platz hier seriös nutzen. Ich bin keine Feindin der Wirtschaft. Wir sind ja alle Teil davon! Dieser Text bewegt sich im Kreislauf der Waren, Sie lesen ihn, ich bekomme Geld dafür. Der Kapitalismus nervt brutal, aber Sachen kaufen ist super: eine Hose, die genau so „lang“ wie meine Beine ist, neue Wanderschucherl, eine Flasche Champagner für den Mann, den ich von allen am meisten mag (das habe ich fast ohne Wettbewerb herausgefunden).
Sie wissen, eine Welt ohne ihre Ausbeutung können wir uns schwerer vorstellen als ihren Untergang, zumindest kann’s Hollywood nicht. Das Wichtigste, das ich Ihnen hier vermitteln möchte, ist mein Glaube an die Utopie. Und an den Auftrag, unsere Vorstellungskraft mindestens so zu trainieren wie unsere Bauchmuskeln! Ich bin eine große Freundin des Unwahrscheinlichen, des groß Geträumten, des schönen Lebens für alle. Das Gegenteil der faden Weltuntergangs- Dystopien ist die Eutopie, der Zukunftsoptimismus. Den brauchen wir.
Meine Mutter hat sich bis zuletzt über meine wachsende Liebe zum Bergsteigen gewundert. Vor 41 Jahren hatte sie mich besorgt zur Kinderkardiologin getragen, weil mich das Erlernen des aufrechten Ganges so gar nicht reizte. „Nein, die ist nur faul“, sagte die Ärztin. Wenn also aus einem feisten Kleinkind („Pröbstling“) eine immer noch leicht feiste, aber sehr mobile Frau werden kann, wie viel mehr kann aus der Gesellschaft werden? Warum sollte sich so wie das Wandern gegen die Trägheit nicht auch die Vernunft gegen die Ungerechtigkeit durchsetzen?
Und wie lustig ist es eigentlich, wenn Entscheidungsträger den Künstlerinnen bescheiden, ihre Visionen und Projekte seien schön und gut, aber nicht zu bezahlen – und dann selbst milliardenschwere Autobahnprojekte aushecken, für die sie Tunnel durch Granit graben lassen, Felswände sprengen, Hektoliter Beton in Flüssen versenken? Während Schulpsychologinnen und Bibliotheken und Mindestsicherungen zusammengekürzt werden wie der Giersch in meinem Garten? Wenn wir Luftmenschen von einem Milliardenkonjunkturpaket für den Sozialbereich oder ein Landeskunstschulwerk reden, lächeln die vermeintlichen Realos milde. Dabei ist es einfach nur naiv, zu glauben, wir kämen ohne Utopien aus unserem Schlamassel heraus.