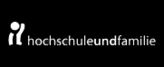Ein Team des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) bereitet aktuell die Arbeiten an einem neuen Lehrplan für die kaufmännischen Vollzeitschulen vor, der mit Beginn des Schuljahres 2025/26 in Kraft treten soll. Nähere Informationen dazu finden Sie hier, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster.
Unser Institut fungierte dabei zum einen als Resonanzgeber. Im Fokus stand die Beurteilung der ins Auge gefassten allgemeinen Bildungsziele und transversalen Kompetenzen sowie die Einschätzung erster Kompetenzstruktur- und Kompetenzentwicklungsmodelle für die kaufmännischen Unterrichtsgegenstände Betriebswirtschaft, Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik unter fachlichen, fachdidaktischen und lernpsychologischen Gesichtspunkten. Die Kolleginnen Univ.-Prof.in Berger, Institut für Entrepreneurship, und Univ.-Prof.in Krumay, Institut für Wirtschaftsinformatik – Information Engineering, haben sich mit wertvollen Inputs in den Prozess eingebracht. Unsere Resonanzstudie finden Sie hier., öffnet eine Datei
Zum anderen wurde ein Konzept für einen neu zu schaffenden Unterrichtsgegenstand „Private Wirtschaftskompetenz (economic literacy)" entworfen. Der Gegenstand soll über zwei Jahre (III. und IV. Jahrgang) geführt werden, maturabel und mit je zwei Wochenstunden dotiert sein. Ausgehend von strategischen Entscheidungen in der Berufs- und Lebensplanung (z. B. Ausbildungs- und Berufswahl, Wahl des Lebensmittelpunktes und der Lebensform, Work-life-Balance, Entscheidungen unter Berücksichtigung von Befunden der psychologischen und der ökonomischen Glücksforschung) wird der Fokus auf die überwiegend operativen Entscheidungen in den Bereichen Finanz- & Verbraucherbildung (Konsumentscheidungen, Geldanlage, Kredite und Versicherungen) sowie Berufs- & Arbeitswelt (Bewerbung, Arbeitsrecht, Steuern usw.) gelegt. Unter Hinführung auf den volkswirtschaftlichen Bereich, der im V. Jahrgang angesiedelt bleibt, werden außerdem die ideellen Grundlagen von Demokratie und freier Marktwirtschaft behandelt und die Grenzen und Probleme marktwirtschaftlicher Koordinationsmechanismen am Modell des Gefangenendilemmas reflektiert. Das Konzept können Sie hier , öffnet eine Dateinachlesen.
Auftrag/Fördergeber:
BMBWF
Laufzeit:
September 2022 bis Jänner 2024
Projektbetreiber:
Univ.-Prof. Dr. Georg Hans Neuweg, Dr.in Simone Stütz
 Zur JKU Startseite
Zur JKU Startseite