
Von elektrischen Schafen, wie im Roman des Science Fiction Schriftstellers Philip K. Dick, träumt Franz Fellner nicht. Ein Androide ist er, soweit wir wissen, auch keiner. Aber ein bisschen nach Science Fiction klingt sein neuer Lehrstuhl für „Virtuelle Morphologie“ an der JKU schon.
„Wir sind uns wohl alle einig, daß [sic] es die Aufgabe von Bildung ... war, ist und wahrscheinlich bleiben wird, die Jugend auf das Leben vorzubereiten. Wenn dies aber der Fall ist, dann steht die Bildung (einschließlich der universitären Bildung) jetzt vor der tiefsten und radikalsten Krise in ihrer an Krisen reichen Geschichte“, erklärte der Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman in einem Vortrag an der Universität Padua.1 Er bezog sich dabei auf seine Theorie der „Liquid Modernity“, die er so beschrieb: „Die Formen des modernen Lebens können sich in einiger Hinsicht unterscheiden – aber was sie alle verbindet, ist genau ihre Zerbrechlichkeit, Zeitlichkeit, Verwundbarkeit und Neigung zu ständigem Wandel.“2 Ein Phänomen, das gerade jetzt eine dramatische Bestätigung erfährt.
Doch funktioniert unser aktuelles Bildungs- und Wissenschaftssystem im Wesentlichen noch immer nach den Prinzipien des Industriezeitalters des 18. und 19. Jahrhunderts: Wissensproduktion, Wissenserwerb, Wissensvermehrung durch intellektuelle Arbeitsteilung. Die Fragmentierung der Wissenslandschaft ist in den letzten Jahrzehnten rasant vorangeschritten. Im Jahr 2018 gab es etwa 42.500 aktive wissenschaftliche Peer- Review- Zeitschriften, die zusammen über drei Millionen Artikel pro Jahr veröffentlichten. Alle zehn Sekunden erscheint ein wissenschaftlicher Artikel.
Parallel dazu ist die Welt immer komplexer geworden. Es scheint: Alles hängt mit allem zusammen. Ein Schiffsunfall im Suezkanal legt Fabriken in Europa lahm. Eine kranke Fledermaus auf einem chinesischen Markt dürfte eine weltweite Pandemie verursacht haben, die unser Sozialverhalten auf den Kopf stellt, mehrere Millionen Todesopfer und enorme wirtschaftliche Schäden fordert.
Fast ein Jahrhundert, nachdem Heisenberg die Unschärferelation formulierte und seine Theorie der Quantenmechanik die Paradigmen der Physik und sogar der Philosophie gebrochen hat, sind wir immer noch gewohnt, weitgehend in isolierten disziplinären Silos mit fragmentiertem Wissen nach linearen Kausalitätsmustern zu argumentieren und zu handeln.
Während die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Realitäten gleichzeitig von der Komplexität einer wachsenden Zahl und in ihren Wechselwirkungen immer unübersichtlicher werdenden Faktoren bestimmt werden, versuchen Politik und Wirtschaft verzweifelt, die lineare Gestaltungslogik des Industriezeitalters aufrechtzuerhalten.
Bildung und Wissenschaft orientieren sich am Paradigma eines Erkenntnisfortschritts, der primär innerhalb von Disziplinen oder subdisziplinären Nischen definiert und anhand von quantitativen bibliometrischen Indikatoren gemessen wird. Dass komplexe Wirkungsmechanismen immer öfter die Grenzen einer wissenschaftlichen Disziplin überschreiten, wird in unserem Bildungs- und Wissenschaftssystem weitgehend ausgeblendet.
Schon 2009 hat der European Research Area Board einen Paradigmenwechsel im Denken und in der Rolle der Wissenschaft gefordert: Ein neues „holistisches Denken“ sei notwendig, Wissenschaft und Forschung sollten „mehr auf die systemischen Effekte achten als auf die engen Ziele“. „Preparing Europe for a New Renaissance“ war der bemerkenswerte Titel des Berichts.3
Der International Science Council, ein Dachverband der prominentesten Forschungsorganisationen aus der ganzen Welt, wie z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der FWF, die Royal Swedish Academy of Sciences, die Schweizerische Akademie der Wissenschaften, die US National Academy of Sciences, die British Academy, hat 2021 einen Bericht veröffentlicht, in dem er die Notwendigkeit betont, „Innovation durch disziplinübergreifende Zusammenarbeit anzuregen“. Man müsse „die gegenwärtigen globalen Herausforderungen als miteinander verflochtene natürliche und soziale Probleme verstehen und gestalten und daher den Sozial- und Geisteswissenschaften sowie der Kunst eine herausragende Führungsrolle zuweisen, ohne die wichtigen Beiträge der Naturwissenschaften, der Ingenieurwissenschaften und der Medizin zu negieren“.4
Bei all dem darf die so dringend gebotene Interdisziplinarität nicht gegen die Vertiefung in den Disziplinen ausgespielt werden. Der unbedingt notwendige Blick über den Tellerrand braucht ein starkes disziplinäres Rückgrat. Interdisziplinarität gelingt meist dort am besten, wo exzellente Vertreterinnen und Vertreter ihres jeweiligen Faches an gemeinsamen fachübergreifenden Projekten arbeiten. Interdisziplinäre Strukturen bedürfen – meist in Form eines iterativen Prozesses – immer wieder des Rückgriff s auf die Exzellenz in den Disziplinen. Wie der Deutsche Wissenschaftsrat daher zu Recht betont, sind Disziplinarität und Interdisziplinarität zugleich konstitutive Elemente des modernen Wissenschaftssystems.5 „Disziplinäre und interdisziplinäre Ansätze können gleichermaßen sachgerecht sein und sind daher grundsätzlich gleichwertig.“
Es ist in der Tat bemerkenswert, dass herausragende Institutionen des globalen Forschungssystems einen Wandel der Wissenschaftskulturen einfordern, weil „das Wissenschaftssystem derzeit nicht so organisiert und motiviert ist, dass Wissenschaftler effektiv dazu beitragen können, Antworten auf globale existenzielle Bedrohungen zu finden und umzusetzen“.6
Die Erkenntnis, dass wir den drängenden globalen Herausforderungen nicht mit „more of the same“ begegnen können, sondern dass wir in Forschung und Lehre die business-as-usual-Ansätze verlassen müssen, scheint an Boden zu gewinnen.
Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde der klassische Kanon der Kulturtechniken – Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen – durch die Fähigkeit zur digitalen Artikulation und Kommunikation ergänzt. Alle, die diese Fähigkeit nicht beherrschten, wurden als digitale Analphabeten mit sozialer Ausgrenzung bestraft und hatten signifikante Nachteile am Arbeitsmarkt zu erleiden.
Jetzt muss dieser Kanon der Kulturtechniken neuerlich erweitert werden.
Die Vermehrung des Wissens in den einzelnen Spezialdisziplinen wird wie gesagt weiter unverzichtbar sein, aber zusätzlich muss unser Bildungssystem die Kompetenz zur Vernetzung von Wissen verstärken – auf einer Ebene, die mit Algorithmen (noch) nicht erreichbar ist und deren Zielrichtung bereits das geltende Universitätsgesetz vorgibt: „Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen.“
Es ist hoch an der Zeit, der kreativen Synthese von Wissen nun mindestens ebenso große Wichtigkeit in unserem Bildungs- und Forschungssystem zuzuerkennen wie der Vermehrung des Wissens. Ungewöhnliche Verbindungen herstellen, Perspektiven wechseln, mit Ungewissheit, Unvorhersehbarkeit und Mehrdeutigkeit arbeiten; deshalb brauchen wir auch das Alphabet der Kunst im Prozess gesellschaftlicher Innovationen in Zeiten radikaler Umbrüche.
1 Bauman, Zygmunt (2011), Liquid modern challenges to education, Lecture given at the Coimbra Group Annual Conference – Padova, 26 May 2011
2 Bauman, Zygmunt (2000), Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, UK
3 European Commission (2009), Preparing Europe for a New Renaissance, A Strategic View of the European Research Area
4 International Science Council (2021), Unleashing Science: Delivering Missions for Sustainability, S. 33
5 Deutscher Wissenschaftsrat (2020), Wissenschaft im Spannungsfeld von Interdisziplinarität und Disziplinarität – Positionspapier, S. 47 f
6 International Science Council (2021), Unleashing Science: Delivering Missions for Sustainability, S. 17


Es gehört zu den Grundfertigkeiten des postheroischen Politikers, der postheroischen Politikerin in Österreich, möglichst nichts Bemerkenswertes zu sagen, nichts, was in Erinnerung bleiben und später einmal gegen einen verwendet werden könnt e. Also man soll sich nur ja nicht bei einer pointierten Formulierung oder gar bei der Wahrheit ertappen lassen. So lebt’s sich legislaturperiodenlang ruhig und angenehm.
Einen gewaltigen Lapsus in Sachen Wahrheits- und Pointenvermeidung hat sich im Frühjahr dieses Jahres Werner Kogler, Österreichs Vizekanzler, geleistet. In der „Zeit im Bild“ hat Kogler am 7. März am Beginn des Ukraine-Krieges die (vorige) Bundesregierung und die Wirtschaftskammer scharf kritisiert – man habe, so Kogler, Putin einen roten Teppich ausgerollt, einen „roten Teppich mit Schleimspur“.
Mein Gott: Mit dem Kogler ist es durchgegangen! Das ist ja – unverzeihlich – glänzend formuliert, und der Mann hat (noch schlimmer) sogar recht. Über Jahre hat man Putin in Österreich den roten Teppich ausgerollt und auf dem Teppich sind die Schleimspuren noch sichtbar – peinliche Flecken, Spuren der Anbiederung.
Die grausliche Schleimspur ist eine unheimliche Erinnerungsspur. Es braucht keine sonderliche Archivrecherche: Österreichs Politik hat Wladimir Putin über Jahre hofiert, mit und ohne Ohrring-Geschenke, man hat rinks wie lechts den Autokraten über Jahrzehnte gewähren lassen – bei der Abschaffung der Pressefreiheit, bei der Annexion der Krim, bei der Bezeichnung der Ukraine als verfehlten Staat usw. usf. Man hat die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl ausgebaut und damit Putin und die Seinen zum Krieg, dem schlimmsten Verbrechen, nachgerade animiert. Der Putinismus, der im Krieg mündete, ist das Ungeheuer, das die österreichische Politik miterzeugt hat.
In einem kleinen, auch heute noch lesenswerten Aufsatz („Über das Unheimliche“) hat Sigmund Freud vor mehr als hundert Jahren auf die eigentümliche Qualität des Unheimlichen hingewiesen. Das Un-Heimliche ist das Gegenteil des Heimeligen und des Heimlichen im Wortsinn: Das, was möglichst heimlich bleiben sollte, kehrt plötzlich wieder, wird un-heimlich. Wird die Aufhebung des Heimlichen öffentlich, erzeugt sie Scham.
Die Reaktion auf die Wiederkehr des Verdrängten? Sie ist eine doppelt empörte: Man ist zunächst empört über den Boten Kogler, der die Sache in Erinnerung gerufen hat und der mit seinem glänzenden Bild vom Teppich und den Spuren darauf gegen den Konsens der Nullrhetorik (siehe oben) verstoßen hat. Die zweite Reaktion ist ebenfalls Empörung, eine ebenso lautstarke wie scheinhafte Empörung, die von Scham und Schuld entlasten soll. Man empört sich nun, da alles zu spät ist, über „den Krieg und seinen Schrecken“, um die Schleimspuren zu verwischen und die Scham zu kompensieren. Bundeskanzler Nehammer reist in einer sinnlosen Desperadoaktion nach Moskau, um sich ein moralisches Fleißzetterl abzuholen, und man hält sich an Künstlerinnen und Sportler. Man fordert in offenen Briefen „vehement“ „öffentliche Stellungnahmen“ ein, stimmen die Aufgeforderten nicht sogleich ein, kritisieren die Haltungslosen deren mangelnde „Haltung“ (und entlassen sie kurzerhand). So verwischt man preisgünstig die Schleimspuren.
Aber eben auch nicht ganz: Dass Kogl er darauf aufmerksam gemacht und das Verdrängte pointiert zu Bewusstsein gebracht hat, ist im politischen Juste Milieu Österreichs ein Skandal. Wir sind ihm dankbar dafür!
Seit dem Beginn der Kriegshandlungen in der Ukraine im Februar hören wir vermehrt Berichte über Geschäfte, die russische Produkte wie Wodka und Pelmeni-Teigtaschen aus dem Sortiment nehmen, russische Kunstschaff ende, die ausgeladen werden und ihre Anstellung verlieren, und Cafés und Restaurants, die russische Gäste nicht mehr bedienen wollen. McDonald’s und andere Unternehmen ziehen sich ganz aus Russland zurück. Diese Handlungen sollen als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine verstanden werden, als Kritik am russischen Regime, und sie sollen die Ukraine durch Schwächung der russischen Wirtschaft unterstützen. Auch wenn die Antwort auf die Frage, wer Aggressor und wer Opfer in der jetzigen Situation wenig zweideutig ist, können und müssen wir erörtern, ob solche Solidaritätsbekundungen und wirtschaftlichen Maßnahmen vertretbar und moralisch gerechtfertigt sind.
In seinem berühmten Aufsatz „Politik als Beruf“ (1919) unterschied Max Weber zwischen zwei unterschiedlichen Standpunkten, von denen man ethisch orientierte Handlungen betrachten kann: dem der Gesinnungsethik und dem der Verantwortungsethik. Der Gesinnungsethiker handelt nach Maximen wie Kants kategorischem Imperativ oder dem liberalen Verbot, grundlegende Rechte von Menschen zu verletzen. Der Verantwortungsethiker schaut auf die Folgen einer Handlung und bewertet sie als moralisch gerechtfertigt, solange sie per Saldo das Gute in der Welt mehren.
Schon von einem gesinnungsethischen Standpunkt sind viele der Boykottmaßnahmen moralisch zumindest problematisch. Der Kern von Kants Imperativ ist die Ansicht, eine Handlung müsse generalisierbar sein, um als moralisch vertretbar zu gelten. Wir sollten also russische Waren oder Künstler nur dann boykottieren, wenn wir auch bereit wären, Vergleichbares in ähnlichen Konflikten zu tun. Das erscheint allerdings wenig ratsam. In der Welt toben zahlreiche Konflikte, und auch wenn uns die Ukraine näher erscheint, ist es nicht gerechtfertigt, hier mit zweierlei Maß zu messen. Zudem ist wahrscheinlich, dass Rechte der Beteiligten verletzt werden, wie z.B eigen das Recht, nicht aufgrund bestimmter Merkmale wie Muttersprache, Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit diskriminiert zu werden.
Eine Schwierigkeit mit der verantwortungsethischen Bewertung ist die genaue Vorhersage der Folgen der Handlung, insbesondere, wenn man sinnvollerweise verlangt, alle Folgen zu berücksichtigen. Was aber klar ist, ist, dass die tatsächlichen Folgen nur selten mit den intendierten Folgen übereinstimmen. Nur weil bestimmt e Maßnahmen das russische Regime schwächen sollen, heißt das nicht, dass sie es auch tun. Vor allem kann es auch eine große Anzahl von Leidtragenden geben, die mit der russischen Politik wenig oder gar nichts zu tun haben. Als Beispiele mögen die Angestellten der russischen McDonald’s-Filialen dienen, die nun ihren Job verlieren, die Zulieferer und Aktionäre von Mc-Donald’s oder die Konsumenten russischer Produkte bei uns.
Natürlich folgt aus Gesagtem nicht, dass es nicht auch sinnvolle Maßnahmen geben kann. Wenn etwa die Auslandsvermögen russischer Oligarchen eingefroren werden, um zu erreichen, dass sie Druck auf die Regierung ausüben, die Kampfhandlungen einzustellen, kann dies durchaus vertretbar sein. In vielen Fällen scheinen sie aber ihr Ziel zu verfehlen und vor allem unbeteiligte Russen und hiesige Konsumenten zu treffen. In solchen Fällen, so wohlintendiert die Maßnahme auch sein mag, müssen von verschiedenen ethischen Standpunkten aus berechtigte Zweifel angemeldet werden.
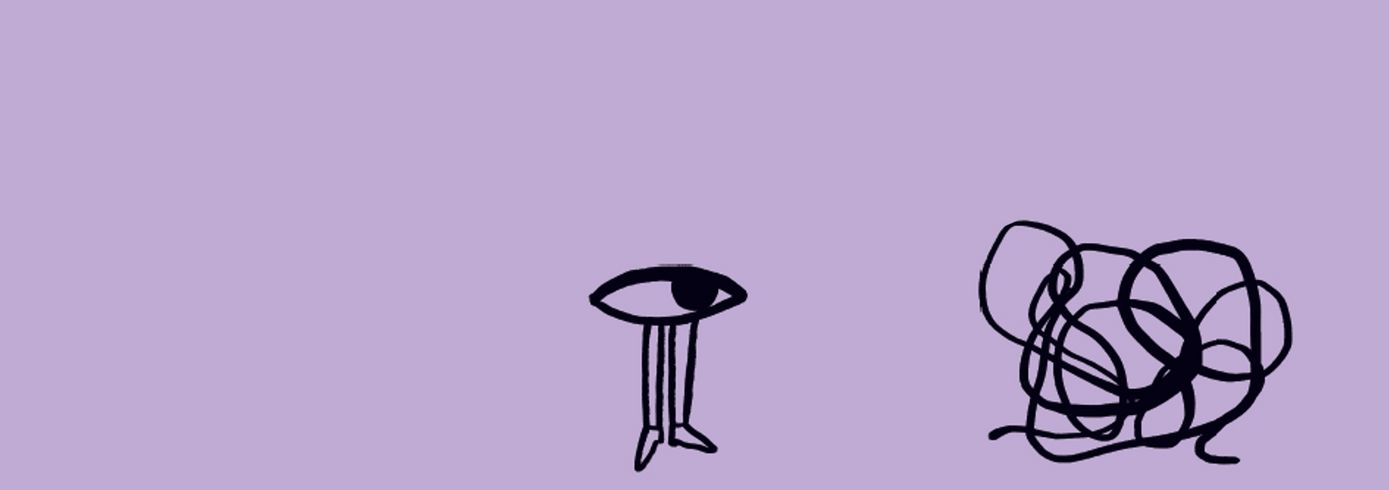

Als Wolfgang von Kempelen in den 1780er Jahren seinen Schachautomaten dem europäischen Publikum vorführte, war der alte Kontinent das Zentrum eines auf Wissenschaft und Technik, aber auch kolonialer Expansion ausdauenden Innovationsgeistes. An der Schwelle zur Industriellen Revolution kannte der Fortschrittsglaube nur eine Richtung: vorwärts!
Heute scheint Europa dagegen ins Hintertreffen zu geraten. Gerade bei den Emerging Technologies „Künstliche Intelligenz“ und „Maschinelles Lernen“ habe man, so der Tenor, den Anschluss an China und die USA verloren. Jetzt ließe sich einwenden, dass dies – gemessen an der Anzahl europäischer Start-ups und publizierter Artikel in ebendiesen Innovationsbereichen – gar nicht mal der Fall ist. Aber ein solches Aufrechnen geht an der eigentlichen Frage vorbei: Was heißt denn „Kreativität“ und „Innovation“ bezogen auf KI?
Kempelens „Wunderwerk der Technik“, das letztlich auch Inspiration für eine Reihe weiterer Erfindungen war, basierte auf einem simplen Trick: Der als Türke verkleidete Automat wurde von einem in der Apparatur versteckten Schachspieler gesteuert. Der „getürkte“ Apparat folgte demnach nicht nur dem rassistischen Imaginär vom unheimlichen, aber irgendwie auch cleveren Orientalen, sondern wurde selbst zum Sinnbild eines auf menschlicher Arbeit aufbauenden Innovationsprozesses. So nimmt „Amazon Mechanical Turk“, eine der größten Micro-labour-Plattformen, die wesentlich zum KI-Erfolg beigetragen haben, direkt Anleihe beim Schachtürken. Mit ihr können repetitive Arbeitsschritte wie das mühsame Kennzeichnen von Datensets an zumeist schlecht bezahlte Arbeitskräfte (Turkers) ausgelagert und damit versteckt werden. Um den Fetisch einer solchen „Artificial Artificial Intelligence“ (Selbstbezeichnung) aufrechtzuerhalten, wird die zur Herstellung ebendieser Intelligenz notwendige Arbeit, das heißt ihre soziale Konstitution, verdrängt.
Der Fetischcharakter von KI führt in eine Sackgasse. Was wollen wir denn von dieser Technologie? Dass sie uns beim Shoppen behilflich ist, unser Auto steuert, unsere Urlaubsbilder taggt oder in unserem Namen – am besten noch mit unserer Stimme – Tischreservierungen vornimmt? Ist das wirklich die große „KI-Revolution“, die wir uns vorstellen?
Anstatt also Heilsversprechen, aber auch Untergangsfantasien hinterherzurennen, bestünde eine echte, kreative Auseinandersetzung mit dieser Zukunftstechnologie darin, sich erst einmal klar darüber zu werden, was für eine Zukunft wir uns da wünschen. Das mag jetzt wieder nach typisch europäischer Innovationsbremse klingen, wäre aber angesichts der bestehenden Herausforderungen (Arbeitsmarkt, Klimawandel, Finanzspekulation, Demokratieversagen etc.) tatsächlich einmal eine Revolution, die ihren Namen verdient.
Interessierte Leser*innen wissen es bereits: Schlagzeilen zu Innovationen in europäischen Unternehmen sind oft negativ. „Der Standard“ veröffentlichte unlängst einen Artikel mit dem Titel „Hat die EU bei Innovationen den Anschluss verloren?“ und schlussfolgert, dass die USA und China europäische Unternehmen in puncto Innovationen abhängen. Weder große Tech-Konzerne noch die wertvollsten Start-ups kommen aus der EU (nur 10% der sogenannten „Unicorns“ stammen aus Europa).
Dabei waren es doch gerade europäische Unternehmen und Forschungsinstitutionen, die das 20. Jahrhundert mit Innovationen prägten. Warum fällt Europa bei Innovationen immer mehr zurück, wie beeinflusst das die europäische Wirtschaft und wie können Innovationen gefördert werden? Die Gründe für das Innovationsdefizit sind vielfältig. Die EU hat zwar wirtschaftlich die Nase vorne, hinkt aber bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung hinterher. Hoch qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland fassen in der EU schwer Fuß. Das liegt einerseits an der Anziehungskraft der USA (v.a. Silicon Valley), andererseits an komplizierten Visa- und Aufenthaltsregeln. So zeigt die „Blaue Karte EU“, das Flaggschiff der EU, um qualifi zierte Fachkräfte nach Europa zu holen, bescheidene Resultate. Diese und weitere Gründe haben weitreichende negative Konsequenzen, wie beispielsweise, dass europäische Unternehmen von ausländischen Herstellern abhängig werden, was wiederum das wirtschaftliche Wachstum langfristig hemmen könnte.
Die Prognosen müssen aber nicht düster bleiben. So kann der Green Dealder EU als Basis für die Entwicklung innovativer Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft gesehen werden. Neben innovativen Ideen braucht es auf der Policy-Ebene auch die Bereitschaft, innovative Unternehmen zu fördern, dabei auf Europas Stärken zu fokussieren und nicht zu versuchen, sogenannte „Silicon Somewheres“ zu etablieren. Schlussendlich braucht es seitens der EU eine bessere Positionierung für hoch qualifizierte internationale Arbeitskräfte. Schließlich ist es allseits bekannt, dass viele bekannte Innovationen ohne Migrant*innen nicht möglich gewesen wären. Die Erfolgsstory der BioNTech-Gründer, die als Einwandererkinder inzwischen eines der weltweit bekanntesten Startups gegründet haben, muss keine Ausnahme bleiben.


Simon Schnetzer ist einer der renommiertesten Jugendforscher im deutschsprachigen Raum. Ein Gespräch über das Nichtgehörtwerden, den stillen Protest und warum
nicht jede*r Influencer*in werden möchte.
In den heutigen europäischen Universitäten ist Weltverbesserung angesagt. Beinahe wäre diese schon ein Studiengang. Wuchernder Kapitalismus, Ökologie, Postkolonialismus, Feminismus, das sind einige der Probleme, die unter Weltverbesserung behandelt werden. Inzwischen ist in vielen europäischen Ländern Gesetz, dass außereuropäische Studenten höhere Studiengebühren zahlen müssen. Da wird nicht mit Weltverbesserung argumentiert, sondern mit nationalem Steuerhaushalt. Geist und Materie lassen sich scheinbar nicht so einfach mit gutem Willen versöhnen.
In der Ankündigung von Weltverbesserung als Zweck eines Studiums liegt ein Kurzschluss. Denn man könnte ja auch genau all diese Problem e ins Auge fassen, ohne überhaupt zu wissen, wie sie zu formulieren sind, wie damit umzugehen, was zu tun ist.
Pointierter gesagt: Nur wenn kein Zweck ihm vorgeschrieben ist, kann ein Problem überhaupt als Problem zutage kommen, befragt und gedacht werden. Nur wenn man endlich der Philosophie den Kopf abschneidet, sie von ihrer Anmaßung, das „Gute“ vorzuschreiben, loslöst, kann wirklich experimentiert werden, was ein ganz anderes Denken sei, hieß es in der Zeitschrift „Acéphale“ (Kopflos), die in den dreißiger Jahren von Bataille, Klossowski und Ambrosini gegründet wurde. Das Bild auf dem Titelblatt, von André Masson gemalt, war eine Reproduktion von Da Vincis „Vitruvianischem Menschen“, aber ohne Kopf und mit einem Totenkopf anstelle der Geschlechtsteile.
Universität bildet selbst immer eine in sich gespaltene Wirklichkeit. Als Institution verfällt sie notwendig dem Universitätsdiskurs, der keine neutral e Instanz ist, sondern die Kontinuität der problematischen gesellschaftlichen Zustände reproduziert, aufrechterhält. Andererseits aber kann das Studium an der Universität diese realen Widersprüche der Gesellschaft als gemeinsame Probleme gestalten und erkunden.
Sind die aktuellen transdisziplinären Bemühungen mehr als ein weiterer Universitätsdiskurs? Darüber entscheidet nicht der angegebene Zweck von Weltverbesserung, sondern die Studenten. So Walter Benjamin 1914: „Es hätte diese Studentenschaft die Universität, die den methodischen Bestand des Wissens samt den vorsichtigen kühnen und doch exakten Versuchen neuer Methoden mitteilt, zu umgeben, gleichwie das undeutliche Wogen des Volkes den Palast eines Fürsten, als die Stätte der beständigen geistigen Revolution, wo zuerst die neuen Fragestellungen weitausgreifender, unklarer, unexakter, aber manchmal vielleicht auch aus tieferer Ahnung, als die wissenschaftlichen Fragen, sich vorbereiten. Die Studentenschaft wäre in ihrer schöpferischen Funktion als der große Transformator zu betrachten, der die neuen Ideen, die früher in der Kunst, früher im sozialen Leben zu erwachen pflegen als in der Wissenschaft, überzuleiten hätt e in wissenschaftliche Fragen durch philosophische Einstellung.“


In der Wirtschaft richtet sich der Blick bereits seit langem auf diverse Teams, auf Personen aus aller Welt, mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Expertisen, die gemeinsam Dialog und Diskurs führen, Ziele entscheiden und Aufgabenstellungen lösen, um in einer zunehmend komplexen und digitalen Arbeitswelt zu bestehen. Wenn wir davon ausgehen, dass Universitäten die zukünftigen „Leader“ ausbilden, die einen Beitrag zur Überwindung großer Herausforderungen in einer globalisierten und volatilen (Arbeits-) Welt leisten sollen, dann müssen Universitäten auch die gesellschaftliche Diversität widerspiegeln.
Dies passiert momentan noch nicht. Wenn ich mich in meinen Kursen umsehe, beschränkt sich die Diversität vorwiegend auf Austauschstudierende aus anderen europäischen Ländern oder den USA und Kanada. Wo bleiben aber die jungen Menschen aus den größten österreichischen Migrant*innengruppen? Wie werden die Lebensrealitäten dieser jungen Menschen berücksichtigt?
Die fehlende Diversität ist ein vernichtendes Urteil für die Rolle der Universitäten als weltoff ene diskursive Institutionen, die versuchen, einer Generation an jungen Leuten gerecht zu werden, welche mit Problemen konfrontiert sind, die global (Klimakrise), komplex (Digitalisierung) und volatil sind (Pandemie). Die jungen Menschen dieser Generation Z, also jene, die zwischen 1997 und 2010 zur Welt gekommen sind, tragen die Folgen unserer Lebensweisen und politischen Weichenstellungen der letzten Jahrzehnte, werden aber – davon handeln die ersten Seiten dieser Ausgabe der Kepler Tribune – in Entscheidungsprozesse kaum bis gar nicht eingebunden. Umso mehr triff t das auf marginalisierte Gruppen zu.
Was bedeutet es aber, Inklusion im universitären Kontext zu leben? Natürlich ist die Universität im Bildungssystem nicht die erste Anlaufstelle, wo das Thema Inklusion anzusprechen ist, wie Melisa Erkurt in ihrem 2020 erschienenen Buch „Generation Haram – Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben“ schildert. Bildungschancen werden in Österreich zu einem großen Teil „vererbt“ und die Bildungsmobilität zwischen den Generationen ist schwach ausgeprägt.
Aber mit einem off enkundigen und starken Fokus auf Inklusion von jungen Menschen aus migrantischen Communitys, aus bildungsfernen Verhältnissen und solchen mit Fluchthintergrund können Universitäten in ihrem Bildungsauftrag eine Lücke füllen, die die Lebensrealität junger Menschen in Österreich widerspiegelt. Sie können zur Ausbildung von diversen Teams in der (Arbeits-)Welt von morgen beitragen, die in der Lage sind, komplexe Herausforderungen durch Kreativität und unterschiedliche Lösungsansätze zu meistern. Universitäten nehmen ihren Ausgangspunkt im kritischen Diskurs des Gestern, des Heute und insbesondere des Morgen. Ihnen kommt der gesellschaftliche Auftrag und gleichsam die einmalige Chance zu, diesen Diskurs zukunftsweisend in Gang zu bringen und in Bewegung zu halten – indem nicht über Diversität geredet wird, sondern Diversität selbstverständliches Element des gemeinsamen Forschens, Lehrens und Aufk lärens wird.
Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ vor mehr als drei Jahrzehnten behauptete eine Zeitdiagnose das „Ende der Geschichte“. Seither beobachten wir das Gegenteil: Gesellschaften wandeln sich rasend schnell. Gegenwärtig wird gar eine Mehrfachkrise diagnostiziert: Klima-, Migrations-, Finanz-, Demokratie- und zuletzt auch Gesundheitskrise. Wenngleich Krisendiagnosen und -therapien variieren, steht eines fest: Es ist kompliziert.
Wie können Gesellschaften die Herausforderungen dieser Mehrfachkrise bewältigen? Autoritäre Regime rühmen sich für rasche und durchschlagende Maßnahmen: China bekommt Covid-19 in den Griff, Ungarn das Flüchtlingsproblem, Singapur den Klimawandel, so deren Selbstdarstellung. Demgegenüber stehen demokratische Gesellschaften in der Kritik, zu langsam und unentschlossen auf die Herausforderungen zu reagieren.
Diese scheinbare Schwäche demokratischer Gesellschaften ist jedoch deren große Stärke: Sie beziehen die Interessen und Werte ganz unterschiedlicher Teile der Bevölkerung mit ein. Dieses Vorgehen kostet viel Zeit und Mühe und endet oft in Kompromissen, keine Frage. Doch es eröffnet nachhaltigere Entwicklungspfade in Richtung einer sozialökologischen Transformation. Der autoritäre Ansatz, einfache Lösungen für komplexe Probleme anzubieten, ist eine Scheinlösung. Der demokratische Ansatz sucht nach Lösungen, die so komplex wie nötig und so einfach wie möglich sind. Allerdings ist er voraussetzungsreich. Er benötigt Akteur*innen, die bereit sind, sich auf den Prozess einzulassen und auch komplexe Antworten zu akzeptieren.
Und diese Akteur*innen müssen über das nötige Wissen verfügen, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Hier kommen auch die Sozial- und Kulturwissenschaften ins Spiel. Sie hinterfragen und ergänzen rein wirtschaftlich oder technologisch orientierte Zugänge. Das Elektroauto allein wird die Klimakrise nicht lösen. Ein Impfstoff allein wird die Gesundheitskrise nicht lösen. Die Sozial- und Kulturwissenschaften betten technologische und wirtschaftliche Maßnahmen in die Gesamtheit politischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Beziehungen ein. Auf diese Weise schaffen sie jene Ressource, die eine demokratische Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit der Mehrfachkrise benötigt: Reflexionswissen. Denn der Weg wird zwar vorwärts gegangen, aber nur rückwärts verstanden.


Vor ein paar Wochen gab mein 20 Jahre alter Geschirrspüler den Geist auf. Bei der Suche nach Ersatz bemerkte ich, welche Entwicklungen ich in diesen 20 Jahren verpasst hatte: Wozu genau braucht mein Geschirrspüler WLAN? Um ihn einzuschalten, während ich einkaufe, bergsteige, arbeite? Damit ich das Geräusch nicht höre? Oder kommuniziert er mit meinem Kühlschrank darüber, dass er die schmutzige Butterdose hat und daher Butter nachbestellt werden muss, selbstverständlich erst, nachdem er beim Tiefkühler nachgefragt hat, ob etwa tiefgekühlte Butter drin ist?
Die von der Industrie entworfenen schönen Bilder des digitalen Haushalts entziehen sich mir. Ich finde hier keine Logik außer die einer Wirtschaft, die alte Dinge neu erfindet, ohne eine nachhaltige Verbesserung zuzulassen.
Die Klimaschutzdebatte wiederum wird vorwiegend von Negativbildern bestimmt. Denn die Klimakatastrophe kommt in komplexen Zusammenhängen. Der persönliche Verzicht aufs Auto soll einen zu heißen Sommer, eine Überschwemmung oder einen Tornado verhindern?
Kompliziert ist ein Uhrwerk, das mithilfe des Wechselns des richtigen Teils und mit der richtigen Expertise repariert werden kann. Komplex wiederum ist etwa der Zusammenhang zwischen der Toilettenpapierknappheit beim ersten Lockdown und der Fledermaus in Wuhan.
Komplexe Probleme haben keine eindeutigen Lösungen. Interdisziplinäre Methoden, d.h. vernetztes Denken, in Beziehung sein, das Verstehen, Hinterfragen und Vermitteln unterschiedlicher Wissensformen und die Fähigkeit zur Herstellung alternativer Realitäten ermöglichen uns, handlungsfähig zu sein. Das sogenannte Ingenieursdenken „Problem A mit Lösung B“ ist in unserer komplexen Welt nicht mehr zeitgemäß. Persönlich erlebe ich, wie vermehrt der Versuch gemacht wird, ins Gespräch zu kommen und wie das interdisziplinäre Aufeinanderzugehen Raum erhält. Das Gespräch, der konstruktive Mehrwert von Missverständnissen und von Vielstimmigkeit sind Grundbedingungen sowohl der inter- und transdisziplinären Arbeit als auch der Demokratiearbeit. Und diese Art des Denkens und Handelns ist im besten Sinn aufregender als eindimensionale Erzählstränge.
Es gibt eine Obsession mit der „linken Identitätspolitik“, so schreibt es der Autor Robert Misik in einem Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung, um im weiteren Verlauf die Gegensätzlichkeit zweier Standpunkte als bloß vermeintlich zu enttarnen. Trotzdem seien behauptete Gegenpositionen auch hier vorangestellt: Auf der einen Seite fänden sich angeblich jene, die die soziale Frage ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen. Und dann gäbe es die, deren Gedanken zur gerechten Gesellschaft sich um einen angeborenen Identitätsbestandteil zentrieren und ihn gewissermaßen losgelöst betrachten, was also heißt, dass sie zwar Rassismus und Sexismus strukturell erkennen, nicht aber Klassismus. So weit, so einfach. Wer bloß binär denken kann, ist klar im Vorteil, weil man dann nicht mit den Zwischentönen durcheinanderkommt und die eigene Meinung als Position unumstößlich in der Landschaft steht.
Cancel Culture von links, bedrohte Kunstfreiheit, Selbstviktimisierung als Waffe: Die Schlagwörter sind bekannt. Aktuell entzünden sie sich innerhalb des Theaterbetriebs an einer Debatte, ausgelöst durch Rassismusvorwürfe gegenüber dem Düsseldorfer Schauspielhaus: So schilderte der Schauspieler Ron Iyamu Ende März rassistische Äußerungen und Übergriffe in Probensituationen. Dagegen hielt der Dramaturg Bernd Stegemann in einem Text in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo er die Besonderheit der Probensituation beschreibt: Stegemann sieht die Probe als Ort der Entgrenzung, an dem die Regeln des Alltags eben nicht gelten, ein Möglichkeitsraum gewissermaßen, in dem Kunst und Künstler* innen erst mal frei sind, ohne dass Einzelne diese Freiheit für ihre Zwecke missbrauchen.
Die Frage nach dem Möglichkeitsraum der Probe ist unbedingt zu stellen. Nicht als Argument gegen Safe Spaces, das die Grenzen des Raumes ziemlich eng zieht und so mehr verunmöglicht, als es eröffnet. Sondern als ein Eintreten für das offene Ausverhandeln des Spielfelds als zukünftigen Common Ground, in dem die Realität durch die Körper der Beteiligten als Realitäten stets präsent, aber nicht festgeschrieben ist.
Denn ein Ausblenden dieser Realitäten wäre wie deren Reduktion ins Singular, wäre Überschreibung und gleichzeitige Zurichtung der Körper, Zugriff und Ausschluss, ein Abziehen der – wie Mithu Sanyal in einer Replik auf Stegemann schreibt – „sozialen Haut, (…) die es uns erlaubt, gleichzeitig Teil der Gesellschaft und wir selbst zu sein – unverletzbar, weil eine Verletzung von uns gleichzeitig eine Verletzung der Gemeinschaft wäre“.


Die mannigfaltigen Krisenerscheinungen des 21. Jahrhunderts (z.B. Finanz-, Migrations- oder Corona-Krise) verstärkten soziale Ungleichheiten. Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Ethnizität oder Religion ist alltäglich. Daher ist der Bedeutungsgewinn von Social-Media-Aktivismus wenig verwunderlich: Marginalisierte Gruppen nutzen Plattformen wie Twitter oder Facebook, um soziale Ungerechtigkeiten breit zu kommunizieren und Verantwortliche unmittelbar zur Rechenschaft zu ziehen.
Dieses Vorgehen wird als canceln bezeichnet und hat u.a. erfolgreich Eliten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, aber auch Wissenschaft unter Druck gesetzt (z.B. #metoo oder #blacklivesmatter). Potenziell führt dieses Vorgehen also zur Ermächtigung von Opfern oder Benachteiligten, unterbindet die Reproduktion von Ungerechtigkeiten und reinigt den öffentlichen Diskurs von problematischen Akteur*innen oder Inhalten.
Warum also hat die Cancel Culture eine negative Konnotation? Sind deliberative Demokratien doch auf aktive Bürger*innen angewiesen, die am öffentlichen Diskurs teilhaben, gesellschaftliche Probleme identifizieren und mittels faktischer Argumente schädliche Diskurselemente entfernen (Habermas).
Der für diesen Diskurs notwendige Möglichkeitsraum hat sich aber sukzessive verengt: Einerseits forcierten politisch meist rechts verortete Kräfte mittels populistischer Rhetorik eine absolute „Wir gegen Sie“-Logik, die emotionalisiert und das faktische Argument verdrängt. Andererseits etablierte sich, insbesondere in politisch links orientierten progressiven Kreisen, eine dogmatische Kultur des politisch Korrekten, deren moralische Fundierung auch bei komplexen Sachfragen unhinterfragbar wirkt. Was einzelne Akteur*innen aber als korrekt verstehen, bleibt im Social Media gestützten Meinungsaustausch meist unspezifisch und bietet Konfliktpotenzial innerhalb progressiver Gruppen.
Und hier zeigt sich das Problem der Cancel Culture: Ohne diskursives Ausverhandeln von Positionen droht die Gefahr, dass eine Cancelation auf das oft unterstellte „Lynchen“ von Individuen reduziert wird, aber die dahinterliegenden legitimen Anliegen von marginalisierten Personengruppen von dem Spektakel inhaltlich verengter Social-Media-Konflikte verdrängt werden. Was schlussendlich auch verhindert, dass die eingangs angesprochenen sozialen Ungerechtigkeiten eine Aufarbeitung erfahren. Und genau dieser Diskurs wäre für Gesellschaften zentral, da er das Potenzial für soziale Kohäsion schaffen könnte.
Manchmal, in schlechten Nächten, träume ich vom Krieg. Ich träume davon, was meine Eltern verloren haben: ihr Geschäft, ihre Arbeit. Ich träume von meiner Stadt, dem Lachen auf den Spielplätzen meiner Kindheit. Dem Bäcker, dem Geruch in den Straßen, dem Basar und den Gebeten in der Moschee. Von einer Stadt, die es nicht mehr gibt, von Erinnerungen an Ecken, die Panzern und Granaten gewichen sind. Vom Feuer, das den Basar vernichtet hat.
Als Kinder und Jugendliche kannten wir Flüchtlinge. Es waren Menschen aus dem Irak, die vor dem Krieg nach Syrien geflohen sind. Da denkt man nicht, wie schnell man selbst in so einer Situation sein kann. Natürlich haben wir in Aleppo im Frühling 2011 ferngesehen. Viele waren auf der Straße. Nie hätten wir gedacht, dass nur wenige Monate später aus den Protesten ein Bürgerkrieg wird.
Die ersten Angriffe auf Aleppo und auf unsere Universität waren schockierend. Wir konnten nicht glauben, dass Syrer auf Syrer schießen. Genauso wenig, wie schnell sich das Leben ändert. Aus den Träumen meiner Generation von einem guten, schönen, freien Leben wurde das Gefühl, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Dass Überleben der letzte Traum ist, der einem noch bleibt. Ein Traum, der aber wie ein nicht endender Albtraum aussieht. Menschen verlieren Geld, Arbeit und Hoffnung. Das Leben dominieren schlaflose Nächte, gefolgt von hoffnungslosen Tagen, gefüllt mit schrecklichen Erlebnissen.
2015 habe ich mich entschieden, Aleppo und Syrien zu verlassen. Ich wollte mein Herz, meinen Kopf und meine Gedanken nicht dem Krieg geben. Ich wollte nehmen, was mir der Krieg gelassen hat, und es in die Welt tragen. Ich wollte wieder träumen. Groß träumen. Träumen von morgen und nicht von gestern.
2017 habe ich an der JKU mein Masterstudium Molecular Biology begonnen und 2020 abgeschlossen. Das Borealis-MORE-Stipendium der JKU half mir finanziell, aber auch mental. Jetzt arbeite ich als Doktorandin am Institut für Biophysik.
Ich trage ein Kopftuch. Es steht für meine Religion und meine Heimat und für eine Generation junger Syrerinnen und Syrer. Wir haben viele verloren. Ich träume von einem Syrien, in dem das entscheidet, was in unseren Köpfen entsteht. Einem Syrien der Wissenschaft, der Offenheit, des Respekts und des Glaubens an unsere gemeinsame Zukunft. Es ist ein großer Traum – aber es ist ein Traum für morgen. Ich träume davon, dass wir es schaffen.
Die Wissenschaft, darüber kann es keine zwei Meinungen geben, ist eine aufregende Sache. In jeder Ausgabe widmen wir ihr deshalb die letzten Zeilen. Dieses Mal spricht Hadil Najjar, die ihr JKU Studium mit Unterstützung eines Borealis-MORE-Stipendiums absolviert hat. Es richtet sich an Studierende mit Fluchthintergrund.
Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: Somnium - Der Traum von Wissenschaft mit Richard Küng

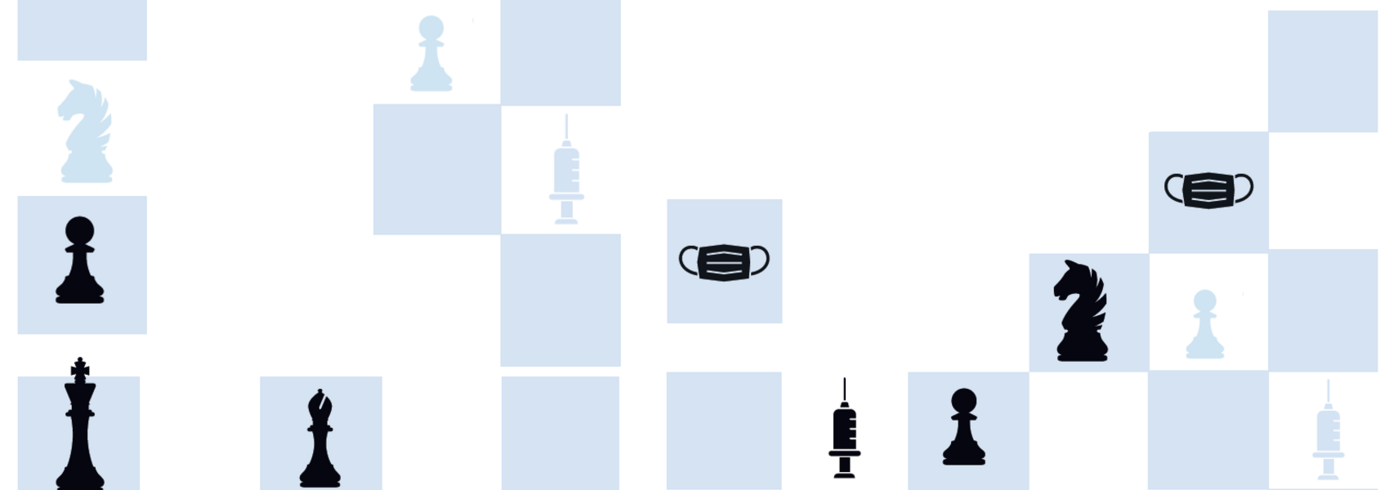
Der Historiker, Philosoph und Bestsellerautor Philipp Blom im Gespräch mit JKU Rektor und Tribune-Herausgeber Meinhard Lukas über mögliche Lehren aus der Corona-Krise und warum off ene Gesellschaften etwas Schwieriges und Lästiges sind – und trotzdem das Beste, das wir haben.